
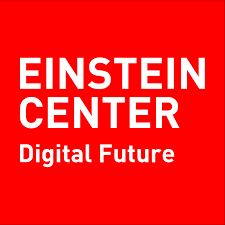
Hänsel und Gretel
Hänsel und Gretel-48
Record of 'Hänsel und Gretel-48' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-48' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-27
Record of 'Hänsel und Gretel-27' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-27' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-68
Record of 'Hänsel und Gretel-68' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-68' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-55
Record of 'Hänsel und Gretel-55' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-55' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-17
Record of 'Hänsel und Gretel-17' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-17' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-31
Record of 'Hänsel und Gretel-31' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-31' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-28
Record of 'Hänsel und Gretel-28' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-28' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-64
Record of 'Hänsel und Gretel-64' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-64' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-13
Record of 'Hänsel und Gretel-13' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-13' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-58
Record of 'Hänsel und Gretel-58' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-58' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-56
Record of 'Hänsel und Gretel-56' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-56' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-5
Record of 'Hänsel und Gretel-5' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-5' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-14
Record of 'Hänsel und Gretel-14' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-14' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-61
Record of 'Hänsel und Gretel-61' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-61' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-60
Record of 'Hänsel und Gretel-60' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-60' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-30
Record of 'Hänsel und Gretel-30' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-30' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-53
Record of 'Hänsel und Gretel-53' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-53' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-22
Record of 'Hänsel und Gretel-22' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-22' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-19
Record of 'Hänsel und Gretel-19' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-19' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-63
Record of 'Hänsel und Gretel-63' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-63' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-33
Record of 'Hänsel und Gretel-33' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-33' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-66
Record of 'Hänsel und Gretel-66' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-66' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-37
Record of 'Hänsel und Gretel-37' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-37' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-59
Record of 'Hänsel und Gretel-59' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-59' by dorothea-mueller
Bild 1

Hänsel und Gretel-31
Hänsel und Gretel-30
Hänsel und Gretel-36
Record of 'Hänsel und Gretel-36' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-36' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-46
Record of 'Hänsel und Gretel-46' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-46' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-4
Record of 'Hänsel und Gretel-4' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-4' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-9
Record of 'Hänsel und Gretel-9' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-9' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-3
Record of 'Hänsel und Gretel-3' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-3' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-44
Record of 'Hänsel und Gretel-44' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-44' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-23
Record of 'Hänsel und Gretel-23' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-23' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-42
Record of 'Hänsel und Gretel-42' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-42' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-20
Record of 'Hänsel und Gretel-20' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-20' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-11
Record of 'Hänsel und Gretel-11' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-11' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-47
Record of 'Hänsel und Gretel-47' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-47' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-67
Record of 'Hänsel und Gretel-67' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-67' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-45
Record of 'Hänsel und Gretel-45' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-45' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-38
Record of 'Hänsel und Gretel-38' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-38' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-35
Record of 'Hänsel und Gretel-35' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-35' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-16
Record of 'Hänsel und Gretel-16' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-16' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-34
Record of 'Hänsel und Gretel-34' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-34' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-2
Record of 'Hänsel und Gretel-2' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-2' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-7
Record of 'Hänsel und Gretel-7' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-7' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-39
Record of 'Hänsel und Gretel-39' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-39' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-41
Record of 'Hänsel und Gretel-41' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-41' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-52
Record of 'Hänsel und Gretel-52' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-52' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-25
Record of 'Hänsel und Gretel-25' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-25' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-43
Record of 'Hänsel und Gretel-43' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-43' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-51
Record of 'Hänsel und Gretel-51' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-51' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-29
Record of 'Hänsel und Gretel-29' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-29' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-54
Record of 'Hänsel und Gretel-54' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-54' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-26
Record of 'Hänsel und Gretel-26' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-26' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-32
Record of 'Hänsel und Gretel-32' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-32' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-12
Record of 'Hänsel und Gretel-12' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-12' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-1
Record of 'Hänsel und Gretel-1' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-1' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-24
Record of 'Hänsel und Gretel-24' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-24' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-21
Record of 'Hänsel und Gretel-21' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-21' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-10
Record of 'Hänsel und Gretel-10' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-10' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-62
Record of 'Hänsel und Gretel-62' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-62' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-8
Record of 'Hänsel und Gretel-8' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-8' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-49
Record of 'Hänsel und Gretel-49' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-49' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-15
Record of 'Hänsel und Gretel-15' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-15' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-15' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-65
Record of 'Hänsel und Gretel-65' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-65' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-6
Record of 'Hänsel und Gretel-6' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-6' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-50
Record of 'Hänsel und Gretel-50' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-50' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-18
Record of 'Hänsel und Gretel-18' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-18' by dorothea-mueller
Hänsel und Gretel-40
Record of 'Hänsel und Gretel-40' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-40' by dorothea-mueller
Bild 3

Hänsel und Gretel-63
Hänsel und Gretel-57
Record of 'Hänsel und Gretel-57' by dorothea-mueller
Record of 'Hänsel und Gretel-57' by dorothea-mueller
Bild 2
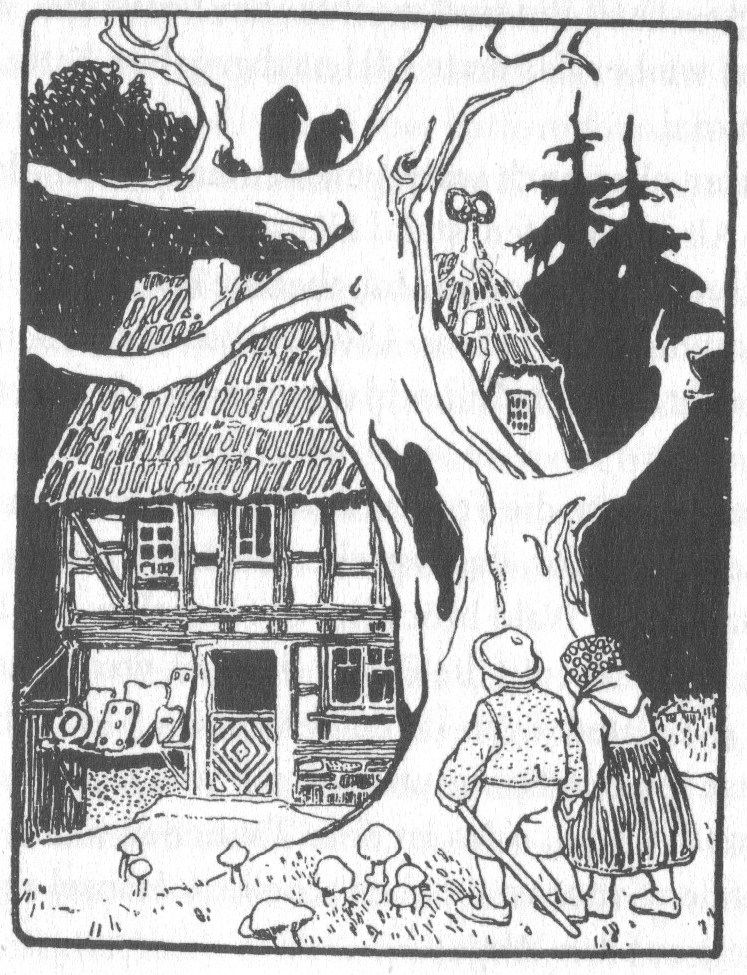
Die tapfere Schneiderin
Die tapfere Schneiderin-96
Record of 'Die tapfere Schneiderin-96' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-96' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-80
Record of 'Die tapfere Schneiderin-80' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-80' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-31
Record of 'Die tapfere Schneiderin-31' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-31' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-93
Record of 'Die tapfere Schneiderin-93' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-93' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-70
Record of 'Die tapfere Schneiderin-70' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-70' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-12
Record of 'Die tapfere Schneiderin-12' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-12' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-10
Record of 'Die tapfere Schneiderin-10' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-10' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-92
Record of 'Die tapfere Schneiderin-92' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-92' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-48
Record of 'Die tapfere Schneiderin-48' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-48' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-84
Record of 'Die tapfere Schneiderin-84' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-84' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-43
Record of 'Die tapfere Schneiderin-43' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-43' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-52
Record of 'Die tapfere Schneiderin-52' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-52' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-7
Record of 'Die tapfere Schneiderin-7' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-7' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-57
Record of 'Die tapfere Schneiderin-57' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-57' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-32
Record of 'Die tapfere Schneiderin-32' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-32' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-56
Record of 'Die tapfere Schneiderin-56' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-56' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-59
Record of 'Die tapfere Schneiderin-59' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-59' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-83
Record of 'Die tapfere Schneiderin-83' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-83' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-2
Record of 'Die tapfere Schneiderin-2' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-2' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-23
Record of 'Die tapfere Schneiderin-23' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-23' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-55
Record of 'Die tapfere Schneiderin-55' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-55' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-33
Record of 'Die tapfere Schneiderin-33' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-33' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-65
Record of 'Die tapfere Schneiderin-65' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-65' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-47
Record of 'Die tapfere Schneiderin-47' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-47' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-49
Record of 'Die tapfere Schneiderin-49' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-49' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-19
Record of 'Die tapfere Schneiderin-19' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-19' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-6
Record of 'Die tapfere Schneiderin-6' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-6' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-79
Record of 'Die tapfere Schneiderin-79' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-79' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-90
Record of 'Die tapfere Schneiderin-90' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-90' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-63
Record of 'Die tapfere Schneiderin-63' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-63' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-28
Record of 'Die tapfere Schneiderin-28' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-28' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-21
Record of 'Die tapfere Schneiderin-21' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-21' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-82
Record of 'Die tapfere Schneiderin-82' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-82' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-3
Record of 'Die tapfere Schneiderin-3' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-3' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-62
Record of 'Die tapfere Schneiderin-62' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-62' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-60
Record of 'Die tapfere Schneiderin-60' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-60' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-94
Record of 'Die tapfere Schneiderin-94' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-94' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-72
Record of 'Die tapfere Schneiderin-72' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-72' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-77
Record of 'Die tapfere Schneiderin-77' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-77' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-73
Record of 'Die tapfere Schneiderin-73' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-73' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-8
Record of 'Die tapfere Schneiderin-8' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-8' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-42
Record of 'Die tapfere Schneiderin-42' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-42' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-69
Record of 'Die tapfere Schneiderin-69' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-69' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-53
Record of 'Die tapfere Schneiderin-53' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-53' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-66
Record of 'Die tapfere Schneiderin-66' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-66' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-22
Record of 'Die tapfere Schneiderin-22' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-22' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-30
Record of 'Die tapfere Schneiderin-30' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-30' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-50
Record of 'Die tapfere Schneiderin-50' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-50' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-89
Record of 'Die tapfere Schneiderin-89' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-89' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-44
Record of 'Die tapfere Schneiderin-44' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-44' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-91
Record of 'Die tapfere Schneiderin-91' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-91' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-86
Record of 'Die tapfere Schneiderin-86' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-86' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-13
Record of 'Die tapfere Schneiderin-13' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-13' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-14
Record of 'Die tapfere Schneiderin-14' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-14' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-81
Record of 'Die tapfere Schneiderin-81' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-81' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-88
Record of 'Die tapfere Schneiderin-88' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-88' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-24
Record of 'Die tapfere Schneiderin-24' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-24' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-17
Record of 'Die tapfere Schneiderin-17' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-17' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-64
Record of 'Die tapfere Schneiderin-64' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-64' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-15
Record of 'Die tapfere Schneiderin-15' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-15' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-61
Record of 'Die tapfere Schneiderin-61' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-61' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-95
Record of 'Die tapfere Schneiderin-95' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-95' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-67
Record of 'Die tapfere Schneiderin-67' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-67' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-46
Record of 'Die tapfere Schneiderin-46' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-46' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-78
Record of 'Die tapfere Schneiderin-78' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-78' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-68
Record of 'Die tapfere Schneiderin-68' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-68' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-16
Record of 'Die tapfere Schneiderin-16' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-16' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-11
Record of 'Die tapfere Schneiderin-11' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-11' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-58
Record of 'Die tapfere Schneiderin-58' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-58' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-75
Record of 'Die tapfere Schneiderin-75' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-75' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-85
Record of 'Die tapfere Schneiderin-85' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-85' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-76
Record of 'Die tapfere Schneiderin-76' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-76' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-25
Record of 'Die tapfere Schneiderin-25' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-25' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-9
Record of 'Die tapfere Schneiderin-9' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-9' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-5
Record of 'Die tapfere Schneiderin-5' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-5' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-18
Record of 'Die tapfere Schneiderin-18' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-18' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-20
Record of 'Die tapfere Schneiderin-20' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-20' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-4
Record of 'Die tapfere Schneiderin-4' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-4' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-45
Record of 'Die tapfere Schneiderin-45' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-45' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-1
Record of 'Die tapfere Schneiderin-1' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-1' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-26
Record of 'Die tapfere Schneiderin-26' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-26' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-27
Record of 'Die tapfere Schneiderin-27' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-27' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-71
Record of 'Die tapfere Schneiderin-71' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-71' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-51
Record of 'Die tapfere Schneiderin-51' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-51' by dorothea-mueller
Die tapfere Schneiderin-34
Record of 'Die tapfere Schneiderin-34' by dorothea-mueller
Record of 'Die tapfere Schneiderin-34' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich
In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön,:: aber die jüngste war so schön, daß die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte so oft sie ihr ins Gesicht schien. ::: Nahe bei dem Schlosse des Königs lag ein großer dunkler Wald, und in dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen: ::: wenn nun der Tag recht heiß war, so ging das Königskind hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens: ::: und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fing sie wieder; und das war ihr liebstes Spielwerk.
Nun trug es sich einmal zu, dass die goldene Kugel der Königstochter nicht in ihr Händchen fiel, das sie in die Höhe gehalten hatte, sondern vorbei auf die Erde schlug und geradezu ins Wasser hinein rollte. ::: Die Königstochter folgte ihr mit den Augen nach, aber die Kugel verschwand, und der Brunnen war tief, so tief dass man keinen Grund sah. ::: Da fing sie an zu weinen und weinte immer lauter und konnte sich gar nicht trösten. ::: Und wie sie so klagte, rief ihr jemand zu „was hast du vor, Königstochter, du schreist ja dass sich ein Stein erbarmen möchte.“ ::: Sie sah sich um, woher die Stimme käme, da erblickte sie einen Frosch, der seinen dicken hässlichen Kopf aus dem Wasser streckte. ::: „Ach, du bists, alter Wasserpatscher,“ sagte sie, „ich weine über meine goldene Kugel, die mir in den Brunnen hinab gefallen ist.“ ::: „Sei still und weine nicht,“ antwortete der Frosch, „ich kann wohl Rat
schaffen, aber was gibst du mir, wenn ich dein Spielwerk wieder heraufhole?“ ::: „Was du haben willst, lieber Frosch,“ sagte sie, „meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine, auch noch die goldene Krone, die ich trage.“ ::: Der Frosch antwortete „deine Kleider, deine Perlen und Edelsteine, und deine goldene Krone, die mag ich nicht: ::: aber wenn du mich lieb haben willst, und ich soll dein Geselle und Spielkamerad sein, an deinem Tischlein neben dir sitzen, von deinem goldenen Tellerlein essen, aus deinem Becherlein trinken, in deinem Bettlein schlafen: wenn du mir das versprichst, so will ich hinunter steigen und dir die goldene Kugel wieder herauf holen.“ ::: „Ach ja,“ sagte sie, „ich verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir nur die Kugel wieder bringst.“ ::: Sie dachte aber „was der einfältige Frosch schwätzt, der sitzt im Wasser bei seines Gleichen und quackt, und kann keines Menschen Geselle sein.“ :::
Der Frosch, als er die Zusage erhalten hatte, tauchte seinen Kopf unter, sank hinab und über ein Weilchen kam er wieder herauf gerudert, hatte die Kugel im Maul und warf sie ins Gras. ::: Die Königstochter war voll Freude, als sie ihr schönes Spielwerk wieder erblickte, hob es auf und sprang damit fort. ::: „Warte, warte,“ rief der Frosch, „nimm mich mit, ich kann nicht so laufen wie du.“ Aber was half ihm dass er ihr sein quack quack so laut nachschrie als er konnte! ::: Sie hörte nicht darauf, eilte nach Haus und hatte bald den armen Frosch vergessen, der wieder in seinen Brunnen hinab steigen musste. :::
Am andern Tage, als sie mit dem König und allen Hofleuten sich zur Tafel gesetzt hatte und von ihrem goldenen Tellerlein aß, da kam, plitsch platsch, plitsch platsch, etwas die Marmortreppe herauf gekrochen, ::: und als es oben angelangt war, klopfte es an der Tür und rief „Königstochter, jüngste, mach mir auf.“ ::: Sie lief und wollte sehen wer draußen wäre, als sie aber aufmachte,
so saß der Frosch davor. Da warf sie die Tür hastig zu, setzte sich wieder an den Tisch, und war ihr ganz angst. ::: Der König sah wohl daß ihr das Herz gewaltig klopfte und sprach „mein Kind, was fürchtest du dich, steht etwa ein Riese vor der Tür und will dich holen?“ :::„Ach nein,“ antwortete sie, „es ist kein Riese, sondern ein garstiger Frosch.“ ::: „Was will der Frosch von dir?“ „Ach lieber Vater, als ich gestern im Wald bei dem Brunnen saß und spielte, da fiel meine goldene Kugel ins Wasser. ::: Und weil ich so weinte, hat sie der Frosch wieder heraufgeholt, und weil er es durchaus verlangte, so versprach ich ihm er sollte mein Geselle werden, ::: ich dachte aber nimmermehr daß er aus seinem Wasser heraus könnte. Nun ist er draußen und will zu mir herein.“ ::: Indem klopfte es zum zweiten Mal und rief
„Königstochter, jüngste,
mach mir auf,
weißt du nicht was gestern
du zu mir gesagt
bei dem kühlen Brunnenwasser?
Königstochter, jüngste,
mach mir auf.“ :::
Da sagte der König „was du versprochen hast, das musst du auch halten; geh nur und mach ihm auf.“ ::: Sie ging und öffnete die Türe, da hüpfte der Frosch herein, ihr immer auf dem Fuße nach, bis zu ihrem Stuhl. ::: Da saß er und rief „heb mich herauf zu dir.“ Sie zauderte bis es endlich der König befahl. ::: Als der Frosch erst auf dem Stuhl war, wollte er auf den Tisch, und als er da saß, sprach er „nun schieb mir dein goldenes Tellerlein näher, damit wir zusammen essen.“ ::: Das tat sie zwar, aber man sah wohl dass sies nicht gerne tat. Der Frosch ließ sichs gut schmecken, aber ihr blieb fast jedes Bisslein im Halse. ::: Endlich sprach er „ich habe mich satt gegessen, und bin müde, nun trag mich in dein Kämmerlein
und mach dein seiden Bettlein zurecht, da wollen wir uns schlafen legen.“ ::: Die Königstochter fing an zu weinen und fürchtete sich vor dem kalten Frosch, den sie nicht anzurühren getraute, und der nun in ihrem schönen reinen Bettlein schlafen sollte. ::: Der König aber ward zornig und sprach „wer dir geholfen hat, als du in der Not warst, den sollst du hernach nicht verachten.“ ::: Da packte sie ihn mit zwei Fingern, trug ihn hinauf und setzte ihn in eine Ecke. Als sie aber im Bett lag, kam er gekrochen und sprach „ich bin müde, ich will schlafen so gut wie du: heb mich herauf, oder ich sags deinem Vater.“ ::: Da ward sie erst bitterböse, holte ihn herauf und warf ihn aus allen Kräften wider die Wand, „nun wirst du Ruhe haben, du garstiger Frosch.“ :::
Als er aber herab fiel, war er kein Frosch, sondern ein Königssohn mit schönen und freundlichen Augen. Der war nun nach ihres Vaters Willen ihr lieber Geselle und Gemahl. Da erzählte er ihr, er wäre von einer bösen Hexe verwünscht worden, und Niemand hätte ihn aus dem Brunnen erlösen können als sie allein, und morgen wollten sie zusammen in sein Reich gehen. ::: Dann schliefen sie ein, und am andern Morgen, als die Sonne sie aufweckte, kam ein Wagen heran gefahren mit acht weißen Pferden bespannt, die hatten weiße Straußfedern auf dem Kopf, und gingen in goldenen Ketten, und hinten stand der Diener des jungen Königs, das war der treue Heinrich. ::: Der treue Heinrich hatte sich so betrübt, als sein Herr war in einen Frosch verwandelt worden, daß er drei eiserne Bande hatte um sein Herz legen lassen, damit es ihm nicht vor Weh und Traurigkeit zerspränge. ::: Der Wagen aber sollte den jungen König in sein Reich abholen; der treue Heinrich hob beide hinein, stellte sich wieder hinten auf und war voller Freude über die Erlösung. ::: Und als sie ein Stück Wegs gefahren waren, hörte der Königssohn dass es hinter ihm krachte, als wäre etwas zerbrochen. Da drehte er sich um und rief :::
„Heinrich, der Wagen bricht.“
„Nein, Herr, der Wagen nicht,
es ist ein Band von meinem Herzen,
das da lag in großen Schmerzen,
als ihr in dem Brunnen saßt,
als ihr eine Fretsche wast.“ :::
Noch einmal und noch einmal krachte es auf dem Weg, und der Königssohn meinte immer der Wagen bräche, und es waren doch nur die Bande, die vom Herzen des treuen Heinrich absprangen, weil sein Herr erlöst und glücklich war. :::
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-23
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-23' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-23' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-41
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-41' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-41' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-24
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-24' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-24' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-43
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-43' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-43' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-15
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-15' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-15' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-16
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-16' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-16' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-40
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-40' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-40' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-2
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-2' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-2' by daniel-hromada
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-2' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-8
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-8' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-8' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-7
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-7' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-7' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-4
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-4' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-4' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-34
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-34' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-34' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-39
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-39' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-39' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-14
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-14' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-14' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-11
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-11' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-11' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-44
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-44' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-44' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-12
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-12' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-12' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-30
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-30' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-30' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-10
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-10' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-10' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-5
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-5' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-5' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-5-2
Nun trug es sich einmal zu, dass die goldene Kugel der Königstochter nicht in ihr Händchen fiel, das sie in die Höhe gehalten hatte, sondern vorbei auf die Erde schlug und geradezu ins Wasser hinein rollte.
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-5-1
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-38
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-38' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-38' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-33
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-33' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-33' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-20
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-20' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-20' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-29
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-29' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-29' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-3
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-3' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-3' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-25
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-25' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-25' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-18
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-18' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-18' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-19
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-19' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-19' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-26
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-26' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-26' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-36
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-36' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-36' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-37
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-37' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-37' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-6
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-6' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-6' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-35
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-35' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-35' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-47
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-47' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-47' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-17
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-17' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-17' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-13
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-13' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-13' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-31
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-31' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-31' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-45
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-45' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-45' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-9
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-9' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-9' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-22
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-22' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-22' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-27
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-27' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-27' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-1
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-1' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-1' by daniel-hromada
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-1' by daniel-hromada
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-1' by daniel-hromada
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-1' by daniel-hromada
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-1' by daniel-hromada
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-1' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-21
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-21' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-21' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-32
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-32' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-32' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-28
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-28' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-28' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-46
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-46' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-46' by dorothea-mueller
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-42
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-42' by dorothea-mueller
Record of 'Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich-42' by dorothea-mueller
Aschenputtel
Aschenputtel-27
Record of 'Aschenputtel-27' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-27' by dorothea-mueller
Aschenputtel-50
Record of 'Aschenputtel-50' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-50' by dorothea-mueller
Aschenputtel-54
Record of 'Aschenputtel-54' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-54' by dorothea-mueller
Aschenputtel-9
Record of 'Aschenputtel-9' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-9' by dorothea-mueller
Aschenputtel-32
Record of 'Aschenputtel-32' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-32' by dorothea-mueller
Aschenputtel-28
Record of 'Aschenputtel-28' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-28' by dorothea-mueller
Aschenputtel-57
Record of 'Aschenputtel-57' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-57' by dorothea-mueller
Aschenputtel-59
Record of 'Aschenputtel-59' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-59' by dorothea-mueller
Aschenputtel-17
Record of 'Aschenputtel-17' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-17' by dorothea-mueller
Aschenputtel-7
Record of 'Aschenputtel-7' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-7' by dorothea-mueller
Aschenputtel-15
Record of 'Aschenputtel-15' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-15' by dorothea-mueller
Aschenputtel-52
Record of 'Aschenputtel-52' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-52' by dorothea-mueller
Aschenputtel-47
Record of 'Aschenputtel-47' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-47' by dorothea-mueller
Aschenputtel-55
Record of 'Aschenputtel-55' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-55' by dorothea-mueller
Aschenputtel-45
Record of 'Aschenputtel-45' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-45' by dorothea-mueller
Aschenputtel-48
Record of 'Aschenputtel-48' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-48' by dorothea-mueller
Aschenputtel-37
Record of 'Aschenputtel-37' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-37' by dorothea-mueller
Aschenputtel-21
Record of 'Aschenputtel-21' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-21' by dorothea-mueller
Aschenputtel-61
Record of 'Aschenputtel-61' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-61' by dorothea-mueller
Aschenputtel-35
Record of 'Aschenputtel-35' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-35' by dorothea-mueller
Aschenputtel-10
Record of 'Aschenputtel-10' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-10' by dorothea-mueller
Aschenputtel-60
Record of 'Aschenputtel-60' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-60' by dorothea-mueller
Aschenputtel-30
Record of 'Aschenputtel-30' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-30' by dorothea-mueller
Aschenputtel-12
Record of 'Aschenputtel-12' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-12' by dorothea-mueller
Aschenputtel-33
Record of 'Aschenputtel-33' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-33' by dorothea-mueller
Aschenputtel-14
Record of 'Aschenputtel-14' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-14' by dorothea-mueller
Aschenputtel-53
Record of 'Aschenputtel-53' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-53' by dorothea-mueller
Aschenputtel-64
Aschenputtel-23
Record of 'Aschenputtel-23' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-23' by dorothea-mueller
Aschenputtel-8
Record of 'Aschenputtel-8' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-8' by dorothea-mueller
Aschenputtel-11
Record of 'Aschenputtel-11' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-11' by dorothea-mueller
Aschenputtel-1
Record of 'Aschenputtel-1' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-1' by dorothea-mueller
Aschenputtel-4
Record of 'Aschenputtel-4' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-4' by dorothea-mueller
Aschenputtel-3
Record of 'Aschenputtel-3' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-3' by dorothea-mueller
Aschenputtel-5
Record of 'Aschenputtel-5' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-5' by dorothea-mueller
Aschenputtel-62
Record of 'Aschenputtel-62' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-62' by dorothea-mueller
Aschenputtel-2
Record of 'Aschenputtel-2' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-2' by dorothea-mueller
Aschenputtel-44
Record of 'Aschenputtel-44' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-44' by dorothea-mueller
Aschenputtel-25
Record of 'Aschenputtel-25' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-25' by dorothea-mueller
Aschenputtel-56
Record of 'Aschenputtel-56' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-56' by dorothea-mueller
Aschenputtel-63
Record of 'Aschenputtel-63' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-63' by dorothea-mueller
Aschenputtel-20
Record of 'Aschenputtel-20' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-20' by dorothea-mueller
Aschenputtel-36
Record of 'Aschenputtel-36' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-36' by dorothea-mueller
Aschenputtel-43
Record of 'Aschenputtel-43' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-43' by dorothea-mueller
Aschenputtel-58
Record of 'Aschenputtel-58' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-58' by dorothea-mueller
Aschenputtel-19
Record of 'Aschenputtel-19' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-19' by dorothea-mueller
Aschenputtel-16
Record of 'Aschenputtel-16' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-16' by dorothea-mueller
Aschenputtel-39
Record of 'Aschenputtel-39' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-39' by dorothea-mueller
Aschenputtel-31
Record of 'Aschenputtel-31' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-31' by dorothea-mueller
Aschenputtel-26
Record of 'Aschenputtel-26' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-26' by dorothea-mueller
Aschenputtel-42
Record of 'Aschenputtel-42' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-42' by dorothea-mueller
Aschenputtel-13
Record of 'Aschenputtel-13' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-13' by dorothea-mueller
Aschenputtel-34
Record of 'Aschenputtel-34' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-34' by dorothea-mueller
Aschenputtel-38
Record of 'Aschenputtel-38' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-38' by dorothea-mueller
Aschenputtel-24
Record of 'Aschenputtel-24' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-24' by dorothea-mueller
Aschenputtel-29
Record of 'Aschenputtel-29' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-29' by dorothea-mueller
Aschenputtel-51
Record of 'Aschenputtel-51' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-51' by dorothea-mueller
Aschenputtel-46
Record of 'Aschenputtel-46' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-46' by dorothea-mueller
Aschenputtel-22
Record of 'Aschenputtel-22' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-22' by dorothea-mueller
Aschenputtel-49
Record of 'Aschenputtel-49' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-49' by dorothea-mueller
Aschenputtel-41
Record of 'Aschenputtel-41' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-41' by dorothea-mueller
Aschenputtel-6
Record of 'Aschenputtel-6' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-6' by dorothea-mueller
Aschenputtel-18
Record of 'Aschenputtel-18' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-18' by dorothea-mueller
Aschenputtel-40
Record of 'Aschenputtel-40' by dorothea-mueller
Record of 'Aschenputtel-40' by dorothea-mueller
Rotkäppchen
Rotkäppchen-9
Record of 'Rotkäppchen-9' by dorothea-mueller
Record of 'Rotkäppchen-9' by dorothea-mueller
Rotkäppchen-24
Record of 'Rotkäppchen-24' by dorothea-mueller
Record of 'Rotkäppchen-24' by dorothea-mueller
Rotkäppchen-22
Record of 'Rotkäppchen-22' by dorothea-mueller
Record of 'Rotkäppchen-22' by dorothea-mueller
Rotkäppchen-7
Record of 'Rotkäppchen-7' by dorothea-mueller
Record of 'Rotkäppchen-7' by dorothea-mueller
Rotkäppchen-3
Record of 'Rotkäppchen-3' by dorothea-mueller
Record of 'Rotkäppchen-3' by dorothea-mueller
Rotkäppchen-16
Record of 'Rotkäppchen-16' by dorothea-mueller
Record of 'Rotkäppchen-16' by dorothea-mueller
Rotkäppchen-27
Record of 'Rotkäppchen-27' by dorothea-mueller
Record of 'Rotkäppchen-27' by dorothea-mueller
Rotkäppchen-8
Record of 'Rotkäppchen-8' by dorothea-mueller
Record of 'Rotkäppchen-8' by dorothea-mueller
Rotkäppchen-19
Record of 'Rotkäppchen-19' by dorothea-mueller
Record of 'Rotkäppchen-19' by dorothea-mueller
Rotkäppchen-5
Record of 'Rotkäppchen-5' by dorothea-mueller
Record of 'Rotkäppchen-5' by daniel-hromada
Record of 'Rotkäppchen-5' by dorothea-mueller
Rotkäppchen-10
Record of 'Rotkäppchen-10' by dorothea-mueller
Record of 'Rotkäppchen-10' by dorothea-mueller
Rotkäppchen-14
Record of 'Rotkäppchen-14' by dorothea-mueller
Record of 'Rotkäppchen-14' by dorothea-mueller
Rotkäppchen-21
Record of 'Rotkäppchen-21' by dorothea-mueller
Record of 'Rotkäppchen-21' by dorothea-mueller
Rotkäppchen-12
Record of 'Rotkäppchen-12' by dorothea-mueller
Record of 'Rotkäppchen-12' by dorothea-mueller
Rotkäppchen-26
Record of 'Rotkäppchen-26' by dorothea-mueller
Record of 'Rotkäppchen-26' by dorothea-mueller
Rotkäppchen-23
Record of 'Rotkäppchen-23' by dorothea-mueller
Record of 'Rotkäppchen-23' by dorothea-mueller
Rotkäppchen-1
Record of 'Rotkäppchen-1' by dorothea-mueller
Record of 'Rotkäppchen-1' by dorothea-mueller
Rotkäppchen-18
Record of 'Rotkäppchen-18' by dorothea-mueller
Record of 'Rotkäppchen-18' by dorothea-mueller
Rotkäppchen-17
Record of 'Rotkäppchen-17' by dorothea-mueller
Record of 'Rotkäppchen-17' by dorothea-mueller
Rotkäppchen-13
Record of 'Rotkäppchen-13' by dorothea-mueller
Record of 'Rotkäppchen-13' by dorothea-mueller
Rotkäppchen-28
Record of 'Rotkäppchen-28' by dorothea-mueller
Record of 'Rotkäppchen-28' by dorothea-mueller
Rotkäppchen-4
Record of 'Rotkäppchen-4' by dorothea-mueller
Record of 'Rotkäppchen-4' by dorothea-mueller
Rotkäppchen-2
Record of 'Rotkäppchen-2' by dorothea-mueller
Record of 'Rotkäppchen-2' by dorothea-mueller
Rotkäppchen-25
Record of 'Rotkäppchen-25' by dorothea-mueller
Record of 'Rotkäppchen-25' by dorothea-mueller
Rotkäppchen-20
Record of 'Rotkäppchen-20' by dorothea-mueller
Record of 'Rotkäppchen-20' by dorothea-mueller
Rotkäppchen-6
Record of 'Rotkäppchen-6' by dorothea-mueller
Record of 'Rotkäppchen-6' by dorothea-mueller
Rotkäppchen-11
Record of 'Rotkäppchen-11' by dorothea-mueller
Record of 'Rotkäppchen-11' by dorothea-mueller
Rotkäppchen-29
Rotkäppchen-15
Record of 'Rotkäppchen-15' by dorothea-mueller
Record of 'Rotkäppchen-15' by dorothea-mueller
Rumpelstilzchen
Rumpelstilzchen-14
Record of 'Rumpelstilzchen-14' by dorothea-mueller
Record of 'Rumpelstilzchen-14' by dorothea-mueller
Rumpelstilzchen-2
Record of 'Rumpelstilzchen-2' by dorothea-mueller
Record of 'Rumpelstilzchen-2' by dorothea-mueller
Rumpelstilzchen-8
Record of 'Rumpelstilzchen-8' by dorothea-mueller
Record of 'Rumpelstilzchen-8' by dorothea-mueller
Rumpelstilzchen-15
Record of 'Rumpelstilzchen-15' by dorothea-mueller
Record of 'Rumpelstilzchen-15' by dorothea-mueller
Rumpelstilzchen-17
Record of 'Rumpelstilzchen-17' by dorothea-mueller
Record of 'Rumpelstilzchen-17' by dorothea-mueller
Rumpelstilzchen-16
Record of 'Rumpelstilzchen-16' by dorothea-mueller
Record of 'Rumpelstilzchen-16' by dorothea-mueller
Rumpelstilzchen-13
Record of 'Rumpelstilzchen-13' by dorothea-mueller
Record of 'Rumpelstilzchen-13' by dorothea-mueller
Rumpelstilzchen-4
Record of 'Rumpelstilzchen-4' by dorothea-mueller
Record of 'Rumpelstilzchen-4' by dorothea-mueller
Rumpelstilzchen-21
Record of 'Rumpelstilzchen-21' by dorothea-mueller
Record of 'Rumpelstilzchen-21' by dorothea-mueller
Rumpelstilzchen-7
Record of 'Rumpelstilzchen-7' by dorothea-mueller
Record of 'Rumpelstilzchen-7' by dorothea-mueller
Rumpelstilzchen-6
Record of 'Rumpelstilzchen-6' by dorothea-mueller
Record of 'Rumpelstilzchen-6' by dorothea-mueller
Rumpelstilzchen-9
Record of 'Rumpelstilzchen-9' by dorothea-mueller
Record of 'Rumpelstilzchen-9' by dorothea-mueller
Rumpelstilzchen-18
Record of 'Rumpelstilzchen-18' by dorothea-mueller
Record of 'Rumpelstilzchen-18' by dorothea-mueller
Rumpelstilzchen-10
Record of 'Rumpelstilzchen-10' by dorothea-mueller
Record of 'Rumpelstilzchen-10' by dorothea-mueller
Rumpelstilzchen-3
Record of 'Rumpelstilzchen-3' by dorothea-mueller
Record of 'Rumpelstilzchen-3' by dorothea-mueller
Rumpelstilzchen-5
Record of 'Rumpelstilzchen-5' by dorothea-mueller
Record of 'Rumpelstilzchen-5' by dorothea-mueller
Rumpelstilzchen-23
Record of 'Rumpelstilzchen-23' by dorothea-mueller
Record of 'Rumpelstilzchen-23' by dorothea-mueller
Rumpelstilzchen-20
Record of 'Rumpelstilzchen-20' by dorothea-mueller
Record of 'Rumpelstilzchen-20' by dorothea-mueller
Rumpelstilzchen-1
Record of 'Rumpelstilzchen-1' by dorothea-mueller
Record of 'Rumpelstilzchen-1' by dorothea-mueller
Rumpelstilzchen-11
Record of 'Rumpelstilzchen-11' by dorothea-mueller
Record of 'Rumpelstilzchen-11' by dorothea-mueller
Rumpelstilzchen-22
Record of 'Rumpelstilzchen-22' by dorothea-mueller
Record of 'Rumpelstilzchen-22' by dorothea-mueller
Rumpelstilzchen-19
Record of 'Rumpelstilzchen-19' by dorothea-mueller
Record of 'Rumpelstilzchen-19' by dorothea-mueller
Rumpelstilzchen-12
Record of 'Rumpelstilzchen-12' by dorothea-mueller
Record of 'Rumpelstilzchen-12' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin
Königin Drosselbärtin-5
Record of 'Königin Drosselbärtin-5' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-5' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-31
Record of 'Königin Drosselbärtin-31' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-31' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-1
Record of 'Königin Drosselbärtin-1' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-1' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-32
Record of 'Königin Drosselbärtin-32' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-32' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-6
Record of 'Königin Drosselbärtin-6' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-6' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-30
Record of 'Königin Drosselbärtin-30' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-30' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-17
Record of 'Königin Drosselbärtin-17' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-17' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-16
Record of 'Königin Drosselbärtin-16' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-16' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-14
Record of 'Königin Drosselbärtin-14' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-14' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-15
Record of 'Königin Drosselbärtin-15' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-15' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-24
Record of 'Königin Drosselbärtin-24' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-24' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-34
Record of 'Königin Drosselbärtin-34' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-34' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-11
Record of 'Königin Drosselbärtin-11' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-11' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-28
Record of 'Königin Drosselbärtin-28' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-28' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-3
Record of 'Königin Drosselbärtin-3' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-3' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-29
Record of 'Königin Drosselbärtin-29' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-29' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-19
Record of 'Königin Drosselbärtin-19' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-19' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-4
Record of 'Königin Drosselbärtin-4' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtino-4' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-25
Record of 'Königin Drosselbärtin-25' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-25' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-27
Record of 'Königin Drosselbärtin-27' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-27' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-7
Record of 'Königin Drosselbärtin-7' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-7' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-9
Record of 'Königin Drosselbärtin-9' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-9' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-13
Record of 'Königin Drosselbärtin-13' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-13' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-22
Record of 'Königin Drosselbärtin-22' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-22' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-18
Record of 'Königin Drosselbärtin-18' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-18' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-20
Record of 'Königin Drosselbärtin-20' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-20' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-23
Record of 'Königin Drosselbärtin-23' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-23' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-12
Record of 'Königin Drosselbärtin-12' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-12' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-10
Record of 'Königin Drosselbärtin-10' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-10' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-33
Record of 'Königin Drosselbärtin-33' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-33' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-2
Record of 'Königin Drosselbärtin-2' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-2' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-26
Record of 'Königin Drosselbärtin-26' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-26' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-8
Record of 'Königin Drosselbärtin-8' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-8' by dorothea-mueller
Königin Drosselbärtin-21
Record of 'Königin Drosselbärtin-21' by dorothea-mueller
Record of 'Königin Drosselbärtin-21' by dorothea-mueller
Dornröschen
Dornröschen-15
Record of 'Dornröschen-15' by dorothea-mueller
Record of 'Dornröschen-15' by dorothea-mueller
Dornröschen-12
Record of 'Dornröschen-12' by dorothea-mueller
Record of 'Dornröschen-12' by dorothea-mueller
Dornröschen-10
Record of 'Dornröschen-10' by dorothea-mueller
Record of 'Dornröschen-10' by dorothea-mueller
Dornröschen-22
Record of 'Dornröschen-22' by dorothea-mueller
Record of 'Dornröschen-22' by dorothea-mueller
Dornröschen-8
Record of 'Dornröschen-8' by dorothea-mueller
Record of 'Dornröschen-8' by dorothea-mueller
Dornröschen-23
Record of 'Dornröschen-23' by dorothea-mueller
Record of 'Dornröschen-23' by dorothea-mueller
Dornröschen-3
Record of 'Dornröschen-3' by dorothea-mueller
Record of 'Dornröschen-3' by dorothea-mueller
Dornröschen-2
Record of 'Dornröschen-2' by dorothea-mueller
Record of 'Dornröschen-2' by dorothea-mueller
Dornröschen-21
Record of 'Dornröschen-21' by dorothea-mueller
Record of 'Dornröschen-21' by dorothea-mueller
Dornröschen-9
Record of 'Dornröschen-9' by dorothea-mueller
Record of 'Dornröschen-9' by dorothea-mueller
Dornröschen-5
Record of 'Dornröschen-5' by dorothea-mueller
Record of 'Dornröschen-5' by dorothea-mueller
Dornröschen-1
Record of 'Dornröschen-1' by dorothea-mueller
Record of 'Dornröschen-1' by dorothea-mueller
Dornröschen-24
Record of 'Dornröschen-24' by dorothea-mueller
Record of 'Dornröschen-24' by dorothea-mueller
Dornröschen-14
Record of 'Dornröschen-14' by dorothea-mueller
Record of 'Dornröschen-14' by dorothea-mueller
Dornröschen-18
Record of 'Dornröschen-18' by dorothea-mueller
Record of 'Dornröschen-18' by dorothea-mueller
Dornröschen-6
Record of 'Dornröschen-6' by dorothea-mueller
Record of 'Dornröschen-6' by dorothea-mueller
Dornröschen-13
Record of 'Dornröschen-13' by dorothea-mueller
Record of 'Dornröschen-13' by dorothea-mueller
Dornröschen-7
Record of 'Dornröschen-7' by dorothea-mueller
Record of 'Dornröschen-7' by dorothea-mueller
Dornröschen-4
Record of 'Dornröschen-4' by dorothea-mueller
Record of 'Dornröschen-4' by dorothea-mueller
Dornröschen-16
Record of 'Dornröschen-16' by dorothea-mueller
Record of 'Dornröschen-16' by dorothea-mueller
Dornröschen-20
Record of 'Dornröschen-20' by dorothea-mueller
Record of 'Dornröschen-20' by dorothea-mueller
Dornröschen-17
Record of 'Dornröschen-17' by dorothea-mueller
Record of 'Dornröschen-17' by dorothea-mueller
Dornröschen-19
Record of 'Dornröschen-19' by dorothea-mueller
Record of 'Dornröschen-19' by dorothea-mueller
Dornröschen-11
Record of 'Dornröschen-11' by dorothea-mueller
Record of 'Dornröschen-11' by dorothea-mueller
Frau Holle
Eine Witwe hatte zwei Töchter, davon war die eine fleißig, die andere faul. Sie hatte aber die faule, weil sie ihre rechte Tochter war, viel lieber, und die andere musste alle Arbeit tun und der Aschenputtel im Hause sein. ::: Das arme Mädchen musste sich täglich auf die große Straße bei einem Brunnen setzen, und musste so viel spinnen, dass ihm das Blut aus den Fingern sprang. Nun trug es sich zu, dass die Spule einmal ganz blutig war, da bückte es sich damit in den Brunnen und wollte sie abwaschen: ::: sie sprang ihm aber aus der Hand und fiel hinab. Es weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück. Sie schalt es aber so heftig und war so unbarmherzig, dass sie sprach „hast du die Spule hinunterfallen lassen, so hol sie auch wieder herauf.“ ::: Da ging das Mädchen zu dem Brunnen zurück und wusste nicht was es anfangen sollte: und in seiner Herzensangst sprang es in den Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Es verlor die Besinnung, und als es erwachte und wieder zu sich selber kam, war es auf einer schönen Wiese wo die Sonne schien und viel tausend Blumen standen. ::: Auf dieser Wiese ging es fort und kam zu einem Backofen, der war voller Brot; das Brot aber rief „ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenn ich: ich bin schon längst ausgebacken.“ ::: Da trat es herzu, und holte mit dem Brotschieber alles nach einander heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum, der hing voll Äpfel, und rief ihm zu „ach schüttel mich, schüttel mich, wir Äpfel sind alle mit einander reif.“ ::: Da schüttelte es den Baum, dass die Äpfel fielen als regneten sie, und schüttelte bis keiner mehr oben war; und als es alle in einen Haufen zusammengelegt hatte, ging es wieder weiter. ::: Endlich kam es zu einem kleinen Haus, daraus guckte eine alte Frau, weil sie aber so große Zähne hatte, ward ihm angst, und es wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihm nach „was fürchtest du dich, liebes Kind? bleib bei mir, wenn du alle Arbeit im Hause ordentlich tun willst, so soll dirs gut gehn. ::: Du musst nur Acht geben dass du mein Bett gut machst und es fleißig aufschüttelst, dass die Federn fliegen, dann schneit es in der Welt; ich bin die Frau Holle.“ ::: Weil die Alte ihm so gut zusprach, so fasste sich das Mädchen ein Herz, willigte ein und begab sich in ihren Dienst. Es besorgte auch alles nach ihrer Zufriedenheit, und schüttelte ihr das Bett immer gewaltig auf dass die Federn wie Schneeflocken umher flogen; ::: dafür hatte es auch ein gut Leben bei ihr, kein böses Wort, und alle Tage Gesottenes und Gebratenes. Nun war es eine zeitlang bei der Frau Holle, da ward es traurig und wusste anfangs selbst nicht was ihm fehlte, endlich merkte es dass es Heimweh war; ::: ob es ihm hier gleich viel tausendmal besser ging als zu Haus, so hatte es doch ein Verlangen dahin. Endlich sagte es zu ihr „ich habe den Jammer nach Haus bekommen, und wenn es mir auch noch so gut hier unten geht, so kann ich doch nicht länger bleiben, ich muss wieder hinauf zu den Meinigen.“ ::: Die Frau Holle sagte „es gefällt mir, dass du wieder nach Haus verlangst, und weil du mir so treu gedient hast, so will ich dich selbst wieder hinauf bringen.“ Sie nahm es darauf bei der Hand und führte es vor ein großes Tor. ::: Das Tor ward aufgetan, und wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen, und alles Gold blieb an ihm hängen, sodass es über und über davon bedeckt war. ::: „Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist“ sprach die Frau Holle und gab ihm auch die Spule wieder, die ihm in den Brunnen gefallen war. Darauf ward das Tor verschlossen, und das Mädchen befand sich oben auf der Welt, nicht weit von seiner Mutter Haus: ::: und als es in den Hof kam, saß der Hahn auf dem Brunnen und rief „kikeriki, unsere goldene Jungfrau ist wieder hie.“ Da ging es hinein zu seiner Mutter, und weil es so mit Gold bedeckt ankam, ward es von ihr und der Schwester gut aufgenommen. ::: Das Mädchen erzählte alles, was ihm begegnet war, und als die Mutter hörte wie es zu dem großen Reichtum gekommen war, wollte sie der andern faulen Tochter gerne dasselbe Glück verschaffen. ::: Sie musste sich an den Brunnen setzen und spinnen; und damit ihre Spule blutig ward, stach sie sich in die Finger und stieß sich die Hand in die Dornhecke. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang selber hinein. ::: Sie kam, wie die andere, auf die schöne Wiese und ging auf demselben Pfade weiter. Als sie zu dem Backofen gelangte, schrie das Brot wieder „ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenn ich, ich bin schon längst ausgebacken.“ ::: Die Faule aber antwortete „da hätt ich Lust mich schmutzig zu machen,“ und ging fort. Bald kam sie zu dem Apfelbaum, der rief „ach, schüttel mich, schüttel mich, wir Äpfel sind alle mit einander reif.“ ::: Sie antwortete aber „du kommst mir recht, es könnte mir einer auf den Kopf fallen,“ und ging damit weiter. ::: Als sie vor der Frau Holle Haus kam, fürchtete sie sich nicht, weil sie von ihren großen Zähnen schon gehört hatte, und verdingte sich gleich zu ihr. Am ersten Tag tat sie sich Gewalt an, war fleißig und folgte der Frau Holle, wenn sie ihr etwas sagte, denn sie dachte an das viele Gold, das sie ihr schenken würde; ::: am zweiten Tag aber fing sie schon an zu faulenzen, am dritten noch mehr, da wollte sie Morgens gar nicht aufstehen. ::: Sie machte auch der Frau Holle das Bett nicht wie sichs gebührte, und schüttelte es nicht, dass die Federn aufflogen. Das ward die Frau Holle bald müde und sagte ihr den Dienst auf. ::: Die Faule war das wohl zufrieden und meinte nun würde der Goldregen kommen; die Frau Holle führte sie auch zu dem Tor, als sie aber darunter stand, ward statt des Goldes ein großer Kessel voll Pech ausgeschüttet. ::: „Das ist zur Belohnung deiner Dienste“ sagte die Frau Holle und schloss das Tor zu. Da kam die Faule heim, aber sie war ganz mit Pech bedeckt, und der Hahn auf dem Brunnen, als er sie sah, rief „kikeriki, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hie.“ ::: Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte, so lange sie lebte, nicht abgehen.
Frau Holle-26
Record of 'Frau Holle-26' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-26' by dorothea-mueller
Frau Holle-19
Record of 'Frau Holle-19' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-19' by dorothea-mueller
Frau Holle-9
Record of 'Frau Holle-9' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-9' by dorothea-mueller
Frau Holle-6
Record of 'Frau Holle-6' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-6' by dorothea-mueller
Frau Holle-21
Record of 'Frau Holle-21' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-21' by dorothea-mueller
Frau Holle-23
Record of 'Frau Holle-23' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-23' by dorothea-mueller
Frau Holle-16
Record of 'Frau Holle-16' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-16' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-16' by dorothea-mueller
Frau Holle-18
Record of 'Frau Holle-18' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-18' by dorothea-mueller
Frau Holle-25
Record of 'Frau Holle-25' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-25' by dorothea-mueller
Frau Holle-1
Record of 'Frau Holle-1' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-1' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-1' by dorothea-mueller
Frau Holle-27
Record of 'Frau Holle-27' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-27' by dorothea-mueller
Frau Holle-24
Record of 'Frau Holle-24' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-24' by dorothea-mueller
Frau Holle-15
Record of 'Frau Holle-15' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-15' by dorothea-mueller
Frau Holle-3
Record of 'Frau Holle-3' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-3' by dorothea-mueller
Frau Holle-22
Record of 'Frau Holle-22' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-22' by dorothea-mueller
Frau Holle-14
Record of 'Frau Holle-14' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-14' by dorothea-mueller
Frau Holle-12
Record of 'Frau Holle-12' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-12' by dorothea-mueller
Frau Holle-20
Record of 'Frau Holle-20' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-20' by dorothea-mueller
Frau Holle-8
Record of 'Frau Holle-8' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-8' by dorothea-mueller
Frau Holle-10
Record of 'Frau Holle-10' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-10' by dorothea-mueller
Frau Holle-11
Record of 'Frau Holle-11' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-11' by dorothea-mueller
Frau Holle-4
Record of 'Frau Holle-4' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-4' by dorothea-mueller
Frau Holle-17
Record of 'Frau Holle-17' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-17' by dorothea-mueller
Frau Holle-7
Record of 'Frau Holle-7' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-7' by dorothea-mueller
Frau Holle-13
Record of 'Frau Holle-13' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-13' by dorothea-mueller
Frau Holle-2
Record of 'Frau Holle-2' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-2' by dorothea-mueller
Frau Holle-5
Record of 'Frau Holle-5' by dorothea-mueller
Record of 'Frau Holle-5' by dorothea-mueller
Hans im Glück
Hans hatte sieben Jahre bei seinem Herrn gedient, da sprach er zu ihm „Herr, meine Zeit ist herum, nun wollte ich gerne wieder heim zu meiner Mutter, gebt mir meinen Lohn.“ ::: Der Herr antwortete „du hast mir treu und ehrlich gedient, wie der Dienst war, so soll der Lohn sein,“ und gab ihm ein Stück Gold, das so groß als Hansens Kopf war. ::: Hans zog sein Tüchlein aus der Tasche, wickelte den Klumpen hinein, setzte ihn auf die Schulter und machte sich auf den Weg nach Haus. Wie er so dahin ging und immer ein Bein vor das andere setzte, kam ihm ein Reiter in die Augen, der frisch und fröhlich auf einem muntern Pferd vorbei trabte. ::: „Ach,“ sprach Hans ganz laut, „was ist das Reiten ein schönes Ding! da sitzt einer wie auf einem Stuhl, stößt sich an keinen Stein, spart die Schuh, und kommt fort, er weiß nicht wie.“ ::: Der Reiter, der das gehört hatte, hielt an und rief „ei, Hans, warum läufst du auch zu Fuß?“ „Ich muß ja wohl,“ antwortete er, „da habe ich einen Klumpen heim zu tragen: es ist zwar Gold, aber ich kann den Kopf dabei nicht grad halten, auch drückt mirs auf die Schulter.“ ::: „Weißt du was,“ sagte der Reiter, „wir wollen tauschen: ich gebe dir mein Pferd, und du gibst mir deinen Klumpen.“ „Von Herzen gern,“ sprach Hans, „aber ich sage euch ihr müsst euch damit schleppen.“ ::: Der Reiter stieg ab, nahm das Gold und half dem Hans hinauf, gab ihm die Zügel fest in die Hände und sprach „wenns nun recht geschwind soll gehen, so musst du mit der Zunge schnalzen, und hopp hopp rufen.“ ::: Hans war seelenfroh, als er auf dem Pferde saß und so frank und frei dahin ritt. ::: Über ein Weilchen fiels ihm ein, es sollte noch schneller gehen, und fing an mit der Zunge zu schnalzen und hopp hopp zu rufen. Das Pferd setzte sich in starken Trab, und ehe sichs Hans versah, war er abgeworfen und lag in einem Graben, der die Äcker von der Landstraße trennte. ::: Das Pferd wäre auch durchgegangen, wenn es nicht ein Bauer aufgehalten hätte, der des Weges kam und eine Kuh vor sich her trieb. ::: Hans suchte seine Glieder zusammen und machte sich wieder auf die Beine. Er war aber verdrießlich und sprach zu dem Bauer „es ist ein schlechter Spaß, das Reiten, zumal, wenn man auf so eine Mähre gerät wie diese, die stößt und einen herabwirft, dass man den Hals brechen kann; ich setze mich nun und nimmermehr wieder auf. ::: Da lob ich mir eure Kuh, da kann einer mit Gemächlichkeit hinter her gehen und hat obendrein seine Milch, Butter und Käse jeden Tag gewiss. Was gäbe ich darum, wenn ich so eine Kuh hätte!“ ::: „Nun,“ sprach der Bauer, „geschieht euch so ein großer Gefallen, so will ich euch wohl die Kuh für das Pferd vertauschen.“ Hans willigte mit tausend Freuden ein: der Bauer schwang sich aufs Pferd und ritt eilig davon. ::: Hans trieb seine Kuh ruhig vor sich her und bedachte den glücklichen Handel. „Hab ich nur ein Stück Brot, und daran wird mirs doch nicht fehlen, so kann ich, so oft mirs beliebt, Butter und Käse dazu essen; hab ich Durst, so melk ich meine Kuh und trinke Milch. ::: Herz, was verlangst du mehr?“ Als er zu einem Wirtshaus kam, machte er Halt, aß in der großen Freude alles, was er bei sich hatte, sein Mittags- und Abendbrot, rein auf, und ließ sich für seine letzten paar Heller ein halbes Glas Bier einschenken. ::: Dann trieb er seine Kuh weiter, immer nach dem Dorfe seiner Mutter zu. Die Hitze ward drückender, je näher der Mittag kam, und Hans befand sich in einer Heide, die wohl noch eine Stunde dauerte. ::: Da ward es ihm ganz heiß, so dass ihm vor Durst die Zunge am Gaumen klebte. „Dem Ding ist zu helfen,“ dachte Hans, „jetzt will ich meine Kuh melken und mich an der Milch laben.“ ::: Er band sie an einen dürren Baum, und da er keinen Eimer hatte, so stellte er seine Ledermütze unter, aber wie er sich auch bemühte, es kam kein Tropfen Milch zum Vorschein. ::: Und weil er sich ungeschickt dabei anstellte, so gab ihm das ungeduldige Tier endlich mit einem der Hinterfüße einen solchen Schlag vor den Kopf, dass er zu Boden taumelte und eine zeitlang sich gar nicht besinnen konnte wo er war. ::: Glücklicherweise kam gerade ein Metzger des Weges, der auf einem Schubkarren ein junges Schwein liegen hatte. „Was sind das für Streiche!“ rief er und half dem guten Hans auf. Hans erzählte was vorgefallen war. ::: Der Metzger reichte ihm seine Flasche und sprach „da trinkt einmal und erholt euch. Die Kuh will wohl keine Milch geben, das ist ein altes Tier, das höchstens noch zum Ziehen taugt oder zum Schlachten.“ ::: „Ei, ei,“ sprach Hans, und strich sich die Haare über den Kopf, „wer hätte das gedacht! es ist freilich gut, wenn man so ein Tier ins Haus abschlachten kann, was gibts für Fleisch! aber ich mache mir aus dem Kuhfleisch nicht viel, es ist mir nicht saftig genug. Ja, wer so ein junges Schwein hätte! das schmeckt anders, dabei noch die Würste.“ ::: „Hört, Hans,“ sprach da der Metzger, „euch zu Liebe will ich tauschen und will euch das Schwein für die Kuh lassen.“ ::: „Gott lohn euch eure Freundschaft“ sprach Hans, übergab ihm die Kuh, ließ sich das Schweinchen vom Karren losmachen und den Strick, woran es gebunden war, in die Hand geben. ::: Hans zog weiter und überdachte wie ihm doch alles nach Wunsch ginge, begegnete ihm ja eine Verdrießlichkeit, so würde sie doch gleich wieder gut gemacht. Es gesellte sich danach ein Bursch zu ihm, der trug eine schöne weiße Gans unter dem Arm. ::: Sie boten einander die Zeit, und Hans fing an von seinem Glück zu erzählen und wie er immer so vorteilhaft getauscht hätte. Der Bursch erzählte ihm dass er die Gans zu einem Kindtaufschmaus brächte. ::: „Hebt einmal,“ fuhr er fort, und packte sie bei den Flügeln, „wie schwer sie ist, die ist aber auch acht Wochen lang genudelt worden. Wer in den Braten beißt, muss sich das Fett von beiden Seiten abwischen.“ ::: „Ja,“ sprach Hans, und wog sie mit der einen Hand, „die hat ihr Gewicht, aber mein Schwein ist auch keine Sau.“ Indessen sah sich der Bursch nach allen Seiten ganz bedenklich um, schüttelte auch wohl mit dem Kopf. ::: „Hört,“ fing er darauf an, „mit eurem Schweine mags nicht ganz richtig sein. In dem Dorfe, durch das ich gekommen bin, ist eben dem Schulzen eins aus dem Stall gestohlen worden. ::: Ich fürchte, ich fürchte, ihr habts da in der Hand. Sie haben Leute ausgeschickt, und es wäre ein schlimmer Handel, wenn sie euch mit dem Schwein erwischten: das geringste ist, dass ihr ins finstere Loch gesteckt werdet.“ ::: Dem guten Hans ward bang, „ach Gott,“ sprach er, „helft mir aus der Not, ihr wisst hier herum bessern Bescheid, nehmt mein Schwein da und lasst mir eure Gans.“ „Ich muss schon etwas aufs Spiel setzen,“ antwortete der Bursche, „aber ich will doch nicht Schuld sein dass ihr ins Unglück geratet.“ ::: Er nahm also das Seil in die Hand und trieb das Schwein schnell auf einen Seitenweg fort: der gute Hans aber ging, seiner Sorgen entledigt, mit der Gans unter dem Arme der Heimat zu. ::: „Wenn ichs recht überlege,“ sprach er mit sich selbst, „habe ich noch Vorteil bei dem Tausch: erstlich den guten Braten, hernach die Menge von Fett, die herausträufeln wird, das gibt Gänsefettbrot auf ein Vierteljahr: und endlich die schönen weißen Federn, die lass ich mir in mein Kopfkissen stopfen, und darauf will ich wohl ungewiegt einschlafen. ::: Was wird meine Mutter eine Freude haben!“ Als er durch das letzte Dorf gekommen war, stand da ein Scherenschleifer mit seinem Karren, sein Rad schnurrte, und er sang dazu „ich schleife die Schere und drehe geschwind, und hänge mein Mäntelchen nach dem Wind.“ ::: Hans blieb stehen und sah ihm zu; endlich redete er ihn an, und sprach „euch gehts wohl, weil ihr so lustig bei eurem Schleifen seid.“ „Ja,“ antwortete der Scherenschleifer, „das Handwerk hat einen güldenen Boden. ::: Ein rechter Schleifer ist ein Mann, der, so oft er in die Tasche greift, auch Geld darin findet. Aber wo habt ihr die schöne Gans gekauft?“ ::: „Die hab ich nicht gekauft, sondern für mein Schwein eingetauscht.“ „Und das Schwein?“ „Das hab ich für eine Kuh gekriegt.“ „Und die Kuh?“ „Die hab ich für ein Pferd bekommen.“ ::: „Und das Pferd?“ „Dafür hab ich einen Klumpen Gold, so groß als mein Kopf, gegeben.“ „Und das Gold?“ „Ei, das war mein Lohn für sieben Jahre Dienst.“ ::: „Ihr habt euch jederzeit zu helfen gewusst,“ sprach der Schleifer, „könnt ihrs nun dahin bringen, dass ihr das Geld in der Tasche springen hört, wenn ihr aufsteht, so habt ihr euer Glück gemacht.“ ::: „Wie soll ich das anfangen?“ sprach Hans „Ihr müsst ein Schleifer werden, wie ich; dazu gehört eigentlich nichts, als ein Wetzstein, das andere findet sich schon von selbst. Da hab ich einen, der ist zwar ein wenig schadhaft, dafür sollt ihr mir aber auch weiter nichts als eure Gans geben; wollt ihr das?“ ::: „Wie könnt ihr noch fragen,“ antwortete Hans, „ich werde ja zum glücklichsten Menschen auf Erden; habe ich Geld, so oft ich in die Tasche greife, was brauche ich da länger zu sorgen?“ reichte ihm die Gans hin, und nahm den Wetzstein in Empfang. ::: „Nun,“ sprach der Schleifer, und hob einen gewöhnlichen schweren Feldstein, der neben ihm lag, auf, „da habt ihr noch einen tüchtigen Stein dazu, auf dem sichs gut schlagen läßt, und ihr eure alten Nägel gerade klopfen könnt. Nehmt hin und hebt ihn ordentlich auf.“ ::: Hans lud den Stein auf und ging mit vergnügtem Herzen weiter; seine Augen leuchteten vor Freude, „ich muss in einer Glückshaut geboren sein,“ rief er aus, „alles was ich wünsche trifft mir ein, wie einem Sonntagskind.“ ::: Indessen, weil er seit Tagesanbruch auf den Beinen gewesen war, begann er müde zu werden; auch plagte ihn der Hunger, da er allen Vorrat auf einmal in der Freude über die erhandelte Kuh aufgezehrt hatte. Er konnte endlich nur mit Mühe weiter gehen und musste jeden Augenblick Halt machen; dabei drückten ihn die Steine ganz erbärmlich. ::: Da konnte er sich des Gedankens nicht erwehren, wie gut es wäre, wenn er sie gerade jetzt nicht zu tragen brauchte. ::: Wie eine Schnecke kam er zu einem Feldbrunnen geschlichen, wollte da ruhen und sich mit einem frischen Trunk laben: damit er aber die Steine im Niedersitzen nicht beschädigte, legte er sie bedächtig neben sich auf den Rand des Brunnens. ::: Darauf setzte er sich nieder und wollte sich zum Trinken bücken, da versah ers, stieß ein klein wenig an, und beide Steine plumpten hinab. ::: Hans, als er sie mit seinen Augen in die Tiefe hatte versinken sehen, sprang vor Freuden auf, kniete dann nieder und dankte Gott mit Tränen in den Augen dass er ihm auch diese Gnade noch erwiesen und ihn auf eine so gute Art und ohne dass er sich einen Vorwurf zu machen brauchte, von den schweren Steinen befreit hätte, die ihm allein noch hinderlich gewesen wären. ::: „So glücklich wie ich,“ rief er aus, „gibt es keinen Menschen unter der Sonne.“ Mit leichtem Herzen und frei von aller Last sprang er nun fort, bis er daheim bei seiner Mutter war
Hans im Glück-10
Record of 'Hans im Glück-10' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-10' by dorothea-mueller
Hans im Glück-22
Record of 'Hans im Glück-22' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-22' by dorothea-mueller
Hans im Glück-17
Record of 'Hans im Glück-17' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-17' by dorothea-mueller
Hans im Glück-46
Record of 'Hans im Glück-46' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-46' by dorothea-mueller
Hans im Glück-42
Record of 'Hans im Glück-42' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-42' by dorothea-mueller
Hans im Glück-20
Record of 'Hans im Glück-20' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-20' by dorothea-mueller
Hans im Glück-36
Record of 'Hans im Glück-36' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-36' by dorothea-mueller
Hans im Glück-47
Record of 'Hans im Glück-47' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-47' by dorothea-mueller
Hans im Glück-4
Record of 'Hans im Glück-4' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-4' by dorothea-mueller
Hans im Glück-3
Record of 'Hans im Glück-3' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-3' by dorothea-mueller
Hans im Glück-12
Record of 'Hans im Glück-12' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-12' by dorothea-mueller
Hans im Glück-38
Record of 'Hans im Glück-38' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-38' by dorothea-mueller
Hans im Glück-33
Record of 'Hans im Glück-33' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-33' by dorothea-mueller
Hans im Glück-40
Record of 'Hans im Glück-40' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-40' by dorothea-mueller
Hans im Glück-7
Record of 'Hans im Glück-7' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-7' by dorothea-mueller
Hans im Glück-28
Record of 'Hans im Glück-28' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-28' by dorothea-mueller
Hans im Glück-2
Record of 'Hans im Glück-2' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-2' by dorothea-mueller
Hans im Glück-19
Record of 'Hans im Glück-19' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-19' by dorothea-mueller
Hans im Glück-45
Record of 'Hans im Glück-45' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-45' by dorothea-mueller
Hans im Glück-32
Record of 'Hans im Glück-32' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-32' by dorothea-mueller
Hans im Glück-13
Record of 'Hans im Glück-13' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-13' by dorothea-mueller
Hans im Glück-34
Record of 'Hans im Glück-34' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-34' by dorothea-mueller
Hans im Glück-21
Record of 'Hans im Glück-21' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-21' by dorothea-mueller
Hans im Glück-18
Record of 'Hans im Glück-18' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-18' by dorothea-mueller
Hans im Glück-14
Record of 'Hans im Glück-14' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-14' by dorothea-mueller
Hans im Glück-43
Record of 'Hans im Glück-43' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-43' by dorothea-mueller
Hans im Glück-16
Record of 'Hans im Glück-16' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-16' by dorothea-mueller
Hans im Glück-29
Record of 'Hans im Glück-29' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-29' by dorothea-mueller
Hans im Glück-23
Record of 'Hans im Glück-23' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-23' by dorothea-mueller
Hans im Glück-24
Record of 'Hans im Glück-24' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-24' by dorothea-mueller
Hans im Glück-26
Record of 'Hans im Glück-26' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-26' by dorothea-mueller
Hans im Glück-1
Record of 'Hans im Glück-1' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-1' by dorothea-mueller
Hans im Glück-11
Record of 'Hans im Glück-11' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-11' by dorothea-mueller
Hans im Glück-37
Record of 'Hans im Glück-37' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-37' by dorothea-mueller
Hans im Glück-30
Record of 'Hans im Glück-30' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-30' by dorothea-mueller
Hans im Glück-39
Record of 'Hans im Glück-39' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-39' by dorothea-mueller
Hans im Glück-48
Record of 'Hans im Glück-48' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-48' by dorothea-mueller
Hans im Glück-27
Record of 'Hans im Glück-27' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-27' by dorothea-mueller
Hans im Glück-35
Record of 'Hans im Glück-35' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-35' by dorothea-mueller
Hans im Glück-8
Record of 'Hans im Glück-8' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-8' by dorothea-mueller
Hans im Glück-49
Record of 'Hans im Glück-49' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-49' by dorothea-mueller
Hans im Glück-44
Record of 'Hans im Glück-44' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-44' by dorothea-mueller
Hans im Glück-31
Record of 'Hans im Glück-31' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-31' by dorothea-mueller
Hans im Glück-6
Record of 'Hans im Glück-6' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-6' by dorothea-mueller
Hans im Glück-9
Record of 'Hans im Glück-9' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-9' by dorothea-mueller
Hans im Glück-25
Record of 'Hans im Glück-25' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-25' by dorothea-mueller
Hans im Glück-41
Record of 'Hans im Glück-41' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-41' by dorothea-mueller
Hans im Glück-15
Record of 'Hans im Glück-15' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-15' by dorothea-mueller
Hans im Glück-5
Record of 'Hans im Glück-5' by dorothea-mueller
Record of 'Hans im Glück-5' by dorothea-mueller
Rapunzel
Es war einmal ein Mann und eine Frau, die wünschten sich schon lange vergeblich ein Kind, endlich machte sich die Frau Hoffnung der liebe Gott werde ihren Wunsch erfüllen. ::: Die Leute hatten in ihrem Hinterhaus ein kleines Fenster, daraus konnte man in einen prächtigen Garten sehen, der voll der schönsten Blumen und Kräuter stand; er war aber von einer hohen Mauer umgeben, und niemand wagte hinein zu gehen, weil er einer Zauberin gehörte, die große Macht hatte und von aller Welt gefürchtet ward. ::: Eines Tags stand die Frau an diesem Fenster und sah in den Garten hinab, da erblickte sie ein Beet, das mit den schönsten Rapunzeln bepflanzt war: und sie sahen so frisch und grün aus, dass sie lüstern ward und das größte Verlangen empfand von den Rapunzeln zu essen. ::: Das Verlangen nahm jeden Tag zu, und da sie wusste dass sie keine davon bekommen konnte, so fiel sie ganz ab, sah blass und elend aus. Da erschrak der Mann und fragte „was fehlt dir, liebe Frau?“ ::: „Ach,“ antwortete sie, „wenn ich keine Rapunzeln aus dem Garten hinter unserm Hause zu essen kriege, so sterbe ich.“ Der Mann, der sie lieb hatte, dachte „eh du deine Frau sterben lässt, holst du ihr von den Rapunzeln, es mag kosten was es wolle.“ ::: In der Abenddämmerung stieg er also über die Mauer in den Garten der Zauberin, stach in aller Eile eine Hand voll Rapunzeln und brachte sie seiner Frau. Sie machte sich sogleich Salat daraus und aß sie in voller Begierde auf. ::: Sie hatten ihr aber so gut, so gut geschmeckt, dass sie den andern Tag noch dreimal so viel Lust bekam. Sollte sie Ruhe haben, so musste der Mann noch einmal in den Garten steigen. ::: Er machte sich also in der Abenddämmerung wieder hinab, als er aber die Mauer herabgeklettert war, erschrak er gewaltig, denn er sah die Zauberin vor sich stehen. ::: „Wie kannst du es wagen,“ sprach sie mit zornigem Blick, „in meinen Garten zu steigen und wie ein Dieb mir meine Rapunzeln zu stehlen? Das soll dir schlecht bekommen.“ ::: „Ach,“ antwortete er, „lasst Gnade für Recht ergehen, ich habe mich nur aus Not dazu entschlossen: meine Frau hat eure Rapunzeln aus dem Fenster erblickt, und empfindet ein so großes Gelüsten, dass sie sterben würde, wenn sie nicht davon zu essen bekäme.“ ::: Da ließ die Zauberin in ihrem Zorne nach und sprach zu ihm „verhält es sich so, wie du sagst, so will ich dir gestatten Rapunzeln mitzunehmen so viel du willst, allein ich mache eine Bedingung: du musst mir das Kind geben, das deine Frau zur Welt bringen wird. Es soll ihm gut gehen, und ich will für es sorgen wie eine Mutter.“ ::: Der Mann sagte in der Angst alles zu, und als die Frau in Wochen kam, so erschien sogleich die Zauberin, gab dem Kinde den Namen Rapunzel und nahm es mit sich fort. ::: Rapunzel ward das schönste Kind unter der Sonne. Als es zwölf Jahre alt war, schloss es die Zauberin in einen Turm, der in einem Walde lag, und weder Treppe noch Türe hatte, nur ganz oben war ein kleines Fensterchen. ::: Wenn die Zauberin hinein wollte, so stellte sie sich unten hin, und rief „Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter.“ Rapunzel hatte lange prächtige Haare, fein wie gesponnen Gold. ::: Wenn sie nun die Stimme der Zauberin vernahm, so band sie ihre Zöpfe los, wickelte sie oben um einen Fensterhaken, und dann fielen die Haare zwanzig Ellen tief herunter, und die Zauberin stieg daran hinauf. ::: Nach ein paar Jahren trug es sich zu, dass der Sohn des Königs durch den Wald ritt und an dem Turm vorüber kam. Da hörte er einen Gesang, der war so lieblich, dass er still hielt und horchte. ::: Das war Rapunzel, die in ihrer Einsamkeit sich die Zeit damit vertrieb, ihre süße Stimme erschallen zu lassen. Der Königssohn wollte zu ihr hinauf steigen und suchte nach einer Türe des Turms, aber es war keine zu finden. ::: Er ritt heim, doch der Gesang hatte ihm so sehr das Herz gerührt, dass er jeden Tag hinaus in den Wald ging und zuhörte. Als er einmal so hinter einem Baum stand, sah er dass eine Zauberin heran kam und hörte wie sie hinauf rief „Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter.“ ::: Da ließ Rapunzel die Haarflechten herab, und die Zauberin stieg zu ihr hinauf. „Ist das die Leiter, auf welcher man hinauf kommt, so will ich auch einmal mein Glück versuchen.“ ::: Und den folgenden Tag, als es anfing dunkel zu werden, ging er zu dem Turme und rief „Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter.“ Alsbald fielen die Haare herab und der Königssohn stieg hinauf. ::: Anfangs erschrak Rapunzel gewaltig als ein Mann zu ihr herein kam, wie ihre Augen noch nie einen erblickt hatten, doch der Königssohn fing an ganz freundlich mit ihr zu reden und erzählte ihr dass von ihrem Gesang sein Herz so sehr sei bewegt worden, dass es ihm keine Ruhe gelassen, und er sie selbst habe sehen müssen. ::: Da verlor Rapunzel ihre Angst, und als er sie fragte ob sie ihn zum Manne nehmen wollte, und sie sah dass er jung und schön war, so dachte sie „der wird mich lieber haben als die alte Frau Gothel,“ und sagte ja und legte ihre Hand in seine Hand. ::: Sie sprach „ich will gerne mit dir gehen, aber ich weiß nicht wie ich herab kommen kann. Wenn du kommst, so bring jedesmal einen Strang Seide mit, daraus will ich eine Leiter flechten und wenn die fertig ist, so steige ich herunter und du nimmst mich auf dein Pferd.“ ::: Sie verabredeten dass er bis dahin alle Abend zu ihr kommen sollte, denn bei Tag kam die Alte. Die Zauberin merkte auch nichts davon, bis einmal Rapunzel anfing und zu ihr sagte „sag sie mir doch, Frau Gothel, wie kommt es nur, sie wird mir viel schwerer heraufzuziehen, als der junge Königssohn, der ist in einem Augenblick bei mir.“ ::: „Ach du gottloses Kind,“ rief die Zauberin, „was muss ich von dir hören, ich dachte ich hätte dich von aller Welt geschieden, und du hast mich doch betrogen!“ In ihrem Zorne packte sie die schönen Haare der Rapunzel, schlug sie ein paar mal um ihre linke Hand, griff eine Schere mit der rechten, und ritsch, ratsch, waren sie abgeschnitten, und die schönen Flechten lagen auf der Erde. ::: Und sie war so unbarmherzig dass sie die arme Rapunzel in eine Wüstenei brachte, wo sie in großem Jammer und Elend leben musste. ::: Denselben Tag aber, wo sie Rapunzel verstoßen hatte, machte abends die Zauberin die abgeschnittenen Flechten oben am Fensterhaken fest, und als der Königssohn kam und rief „Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter,“ so ließ sie die Haare hinab. ::: Der Königssohn stieg hinauf, aber er fand oben nicht seine liebste Rapunzel, sondern die Zauberin, die ihn mit bösen und giftigen Blicken ansah. ::: „Aha,“ rief sie höhnisch, „du willst die Frau Liebste holen, aber der schöne Vogel sitzt nicht mehr im Nest und singt nicht mehr, die Katze hat ihn geholt und wird dir auch noch die Augen auskratzen. Für dich ist Rapunzel verloren, du wirst sie nie wieder erblicken.“ ::: Der Königssohn geriet außer sich vor Schmerz, und in der Verzweiflung sprang er den Turm herab: das Leben brachte er davon, aber die Dornen, in die er fiel, zerstachen ihm die Augen. ::: Da irrte er blind im Walde umher, aß nichts als Wurzeln und Beeren, und tat nichts als jammern und weinen über den Verlust seiner liebsten Frau. ::: So wanderte er einige Jahre im Elend umher und geriet endlich in die Wüstenei, wo Rapunzel mit den Zwillingen, die sie geboren hatte, einem Knaben und Mädchen, kümmerlich lebte. ::: Er vernahm eine Stimme, und sie kam ihm so bekannt vor: da ging er darauf zu, und wie er heran kam, erkannte ihn Rapunzel und fiel ihm um den Hals und weinte. ::: Zwei von ihren Tränen aber benetzten seine Augen, da wurden sie wieder klar, und er konnte damit sehen wie sonst. Er führte sie in sein Reich, wo er mit Freude empfangen ward, und sie lebten noch lange glücklich und vergnügt.
Rapunzel-34
Record of 'Rapunzel-34' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-34' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-34' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-34' by dorothea-mueller
Rapunzel-14
Record of 'Rapunzel-14' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-14' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-14' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-14' by dorothea-mueller
Rapunzel-15
Record of 'Rapunzel-15' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-15' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-15' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-15' by dorothea-mueller
Rapunzel-11
Record of 'Rapunzel-11' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-11' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-11' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-11' by dorothea-mueller
Rapunzel-12
Record of 'Rapunzel-12' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-12' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-12' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-12' by dorothea-mueller
Rapunzel-3
Record of 'Rapunzel-3' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-3' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-3' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-3' by dorothea-mueller
Rapunzel-31
Record of 'Rapunzel-31' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-31' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-31' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-31' by dorothea-mueller
Rapunzel-21
Record of 'Rapunzel-21' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-21' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-21' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-21' by dorothea-mueller
Rapunzel-5
Record of 'Rapunzel-5' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-5' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-5' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-5' by dorothea-mueller
Rapunzel-1
Record of 'Rapunzel-1' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-1' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-1' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-1' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-1' by dorothea-mueller
Rapunzel-19
Record of 'Rapunzel-19' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-19' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-19' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-19' by dorothea-mueller
Rapunzel-33
Record of 'Rapunzel-33' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-33' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-33' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-33' by dorothea-mueller
Rapunzel-7
Record of 'Rapunzel-7' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-7' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-7' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-7' by dorothea-mueller
Rapunzel-16
Record of 'Rapunzel-16' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-16' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-16' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-16' by dorothea-mueller
Rapunzel-25
Record of 'Rapunzel-25' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-25' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-25' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-25' by dorothea-mueller
Rapunzel-30
Record of 'Rapunzel-30' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-30' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-30' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-30' by dorothea-mueller
Rapunzel-32
Record of 'Rapunzel-32' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-32' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-32' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-32' by dorothea-mueller
Rapunzel-4
Record of 'Rapunzel-4' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-4' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-4' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-4' by dorothea-mueller
Rapunzel-28
Record of 'Rapunzel-28' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-28' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-28' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-28' by dorothea-mueller
Rapunzel-24
Record of 'Rapunzel-24' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-24' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-24' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-24' by dorothea-mueller
Rapunzel-9
Record of 'Rapunzel-9' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-9' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-9' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-9' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-9' by dorothea-mueller
Rapunzel-8
Record of 'Rapunzel-8' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-8' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-8' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-8' by dorothea-mueller
Rapunzel-6
Record of 'Rapunzel-6' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-6' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-6' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-6' by dorothea-mueller
Rapunzel-10
Record of 'Rapunzel-10' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-10' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-10' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-10' by dorothea-mueller
Rapunzel-18
Record of 'Rapunzel-18' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-18' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-18' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-18' by dorothea-mueller
Rapunzel-2
Record of 'Rapunzel-2' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-2' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-2' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-2' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-2' by dorothea-mueller
Rapunzel-29
Record of 'Rapunzel-29' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-29' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-29' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-29' by dorothea-mueller
Rapunzel-20
Record of 'Rapunzel-20' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-20' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-20' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-20' by dorothea-mueller
Rapunzel-22
Record of 'Rapunzel-22' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-22' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-22' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-22' by dorothea-mueller
Rapunzel-17
Record of 'Rapunzel-17' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-17' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-17' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-17' by dorothea-mueller
Rapunzel-23
Record of 'Rapunzel-23' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-23' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-23' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-23' by dorothea-mueller
Rapunzel-27
Record of 'Rapunzel-27' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-27' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-27' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-27' by dorothea-mueller
Rapunzel-26
Record of 'Rapunzel-26' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-26' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-26' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-26' by dorothea-mueller
Rapunzel-13
Record of 'Rapunzel-13' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-13' by dorothea-mueller
Record of 'Rapunzel-13' by daniel-hromada
Record of 'Rapunzel-13' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot
Eine arme Wittwe, die lebte einsam in einem Hüttchen, und vor dem Hüttchen war ein Garten, darin standen zwei Rosenbäumchen, davon trug das eine weiße, das andere rote Rosen: und sie hatte zwei Kinder, die glichen den beiden Rosenbäumchen, und das eine hieß Schneeweißchen, das andere Rosenrot. ::: Sie waren aber so fromm und gut, so arbeitsam und unverdrossen, als je zwei Kinder auf der Welt gewesen sind: Schneeweißchen war nur stiller und sanfter als Rosenrot. ::: Rosenrot sprang lieber in den Wiesen und Feldern umher, suchte Blumen und fing Sommervögel: Schneeweißchen aber saß daheim bei der Mutter, half ihr im Hauswesen oder las ihr vor, wenn nichts zu tun war. ::: Die beiden Kinder hatten einander so lieb, dass sie sich immer an den Händen fassten, so oft sie zusammen ausgingen: und wenn Schneeweißchen sagte „wir wollen uns nicht verlassen,“ so antwortete Rosenrot „so lange wir leben nicht,“ und die Mutter setzte hinzu „was das eine hat solls mit dem andern teilen.“ ::: Oft liefen sie im Walde allein umher und sammelten rote Beeren, aber kein Tier tat ihnen etwas zu leid, sondern sie kamen vertraulich herbei: das Häschen fraß ein Kohlblatt aus ihren Händen, das Reh graste an ihrer Seite, der Hirsch sprang ganz lustig vorbei und die Vögel blieben auf den Ästen sitzen und sangen was sie nur wussten. ::: Kein Unfall traf sie: wenn sie sich im Walde verspätet hatten und die Nacht sie überfiel, so legten sie sich nebeneinander auf das Moos und schliefen bis der Morgen kam, und die Mutter wusste das und hatte ihretwegen keine Sorge. ::: Einmal, als sie im Walde übernachtet hatten und das Morgenrot sie aufweckte, da sahen sie ein schönes Kind in einem weißen glänzenden Kleidchen neben ihrem Lager sitzen. ::: Es stand auf und blickte sie ganz freundlich an, sprach aber nichts und ging in den Wald hinein. Und als sie sich umsahen, so hatten sie ganz nahe bei einem Abgrunde geschlafen, und wären gewiss hinein gefallen, wenn sie in der Dunkelheit noch ein paar Schritte weiter gegangen wären. ::: Die Mutter aber sagte ihnen das müsste der Engel gewesen sein, der gute Kinder bewache. Schneeweißchen und Rosenrot hielten das Hüttchen der Mutter so reinlich, dass es eine Freude war hinein zu schauen. ::: Im Sommer besorgte Rosenrot das Haus und stellte der Mutter jeden Morgen, ehe sie aufwachte, einen Blumenstrauß vors Bett, darin war von jedem Bäumchen eine Rose. Im Winter zündete Schneeweißchen das Feuer an und hing den Kessel an den Feuerhaken, und der Kessel war von Messing, glänzte aber wie Gold, so rein war er gescheuert. ::: Abends, wenn die Flocken fielen, sagte die Mutter „geh, Schneeweißchen, und schieb den Riegel vor,“ und dann setzten sie sich an den Herd, und die Mutter nahm die Brille und las aus einem großen Buche vor, und die beiden Mädchen hörten zu, saßen und spannen; neben ihnen lag ein Lämmchen auf dem Boden, und hinter ihnen auf einer Stange saß ein weißes Täubchen und hatte seinen Kopf unter den Flügel gesteckt. ::: Eines Abends, als sie so vertraulich beisammen saßen, klopfte jemand an die Türe, als wollte er eingelassen sein. Die Mutter sprach „geschwind, Rosenrot, mach auf, es wird ein Wanderer sein, der Obdach sucht.“ ::: Rosenrot ging und schob den Riegel weg und dachte es wäre ein armer Mann, aber der war es nicht, es war ein Bär, der seinen dicken schwarzen Kopf zur Türe herein streckte. Rosenrot schrie laut und sprang zurück: das Lämmchen blöckte, das Täubchen flatterte auf und Schneeweißchen versteckte sich hinter der Mutter Bett. ::: Der Bär aber fing an zu sprechen und sagte „fürchtet euch nicht, ich tue euch nichts zu leid, ich bin halb erfroren und will mich nur ein wenig bei euch wärmen.“ ::: „Du armer Bär,“ sprach die Mutter, „leg dich ans Feuer, und gib nur acht dass dir dein Pelz nicht brennt.“ Dann rief sie „Schneeweißchen, Rosenrot, kommt hervor, der Bär tut euch nichts, er meints ehrlich.“ ::: Da kamen sie beide heran, und nach und nach näherten sich auch das Lämmchen und Täubchen und hatten keine Furcht vor ihm. ::: Der Bär sprach „ihr Kinder, klopft mir den Schnee ein wenig aus dem Pelzwerk,“ und sie holten den Besen und kehrten dem Bär das Fell rein: er aber streckte sich ans Feuer und brummte ganz vergnügt und behaglich. ::: Nicht lange, so wurden sie ganz vertraut und trieben Mutwillen mit dem unbeholfenen Gast. Sie zausten ihm das Fell mit den Händen, setzten ihre Füßchen auf seinen Rücken und wälzten ihn hin und her, oder sie nahmen eine Haselrute und schlugen auf ihn los, und wenn er brummte, so lachten sie. ::: Der Bär ließ sichs aber gerne gefallen, nur wenn sies gar zu arg machten, rief er „lasst mich am Leben, ihr Kinder: Schneeweißchen, Rosenrot, schlägst dir den Freier tot.“ ::: Als Schlafenszeit war und die andern zu Bett gingen, sagte die Mutter zu dem Bär „du kannst in Gottes Namen da am Herde liegen bleiben, so bist du vor der Kälte und dem bösen Wetter geschützt.“ Sobald der Tag graute, ließen ihn die beiden Kinder hinaus, und er trabte über den Schnee in den Wald hinein. ::: Von nun an kam der Bär jeden Abend zu der bestimmten Stunde, legte sich an den Herd und erlaubte den Kindern Kurzweil mit ihm zu treiben, so viel sie wollten; und sie waren so gewöhnt an ihn, dass die Türe nicht eher zugeriegelt ward, als bis der schwarze Gesell angelangt war. ::: Als das Frühjahr herangekommen und draußen alles grün war, sagte der Bär eines Morgens zu Schneeweißchen „nun muss ich fort und darf den ganzen Sommer nicht wieder kommen.“ „Wo gehst du denn hin, lieber Bär?“ fragte Schneeweißchen. ::: „Ich muss in den Wald und meine Schätze vor den bösen Zwergen hüten: im Winter, wenn die Erde hart gefroren ist, müssen sie wohl unten bleiben und können sich nicht durcharbeiten, aber jetzt, wenn die Sonne die Erde aufgetaut und erwärmt hat, da brechen sie durch, steigen herauf, suchen und stehlen; was einmal in ihren Händen ist und in ihren Höhlen liegt, das kommt so leicht nicht wieder an des Tages Licht.“ ::: Schneeweißchen war ganz traurig über den Abschied und als es ihm die Türe aufriegelte, und der Bär sich hinaus drängte, blieb er an dem Türhaken hängen und ein Stück seiner Haut riss auf, und da war es Schneeweißchen, als hätte es Gold durchschimmern gesehen: aber es war seiner Sache nicht gewiss. ::: Der Bär lief eilig fort und war bald hinter den Bäumen verschwunden. Nach einiger Zeit schickte die Mutter die Kinder in den Wald, Reisig zu sammeln. Da fanden sie draußen einen großen Baum, der lag gefällt auf dem Boden, und an dem Stamme sprang zwischen dem Gras etwas auf und ab, sie konnten aber nicht unterscheiden was es war. ::: Als sie näher kamen, sahen sie einen Zwerg mit einem alten verwelkten Gesicht und einem ellenlangen schneeweißen Bart. Das Ende des Bartes war in eine Spalte des Baums eingeklemmt, und der Kleine sprang hin und her wie ein Hündchen an einem Seil und wusste nicht wie er sich helfen sollte. ::: Er glotzte die Mädchen mit seinen roten feurigen Augen an und schrie „was steht ihr da! könnt ihr nicht herbei gehen und mir Beistand leisten?“ „Was hast du angefangen, kleines Männchen?“ fragte Rosenrot. ::: „Dumme neugierige Gans,“ antwortete der Zwerg, „den Baum habe ich mir spalten wollen, um kleines Holz in der Küche zu haben; bei den dicken Klötzen verbrennt gleich das bisschen Speise, das unser einer braucht, der nicht so viel hinunter schlingt als ihr, grobes, gieriges Volk. ::: Ich hatte den Keil schon glücklich hinein getrieben, und es wäre alles nach Wunsch gegangen, aber das verwünschte Holz war zu glatt und sprang unversehens heraus, und der Baum fuhr so geschwind zusammen, dass ich meinen schönen weißen Bart nicht mehr herausziehen konnte; nun steckt er drin, und ich kann nicht fort. Da lachen die albernen glatten Milchgesichter! pfui, was seid ihr garstig!“ ::: Die Kinder gaben sich alle Mühe, aber sie konnten den Bart nicht heraus ziehen, er steckte zu fest. „Ich will laufen und Leute herbei holen“ sagte Rosenrot. „Wahnsinnige Schafsköpfe,“ schnarrte der Zwerg, „wer wird gleich Leute herbeirufen, ihr seid mir schon um zwei zu viel; fällt euch nicht besseres ein?“ ::: „Sei nur nicht ungeduldig,“ sagte Schneeweißchen, „ich will schon Rat schaffen,“ holte seine Schere aus der Tasche und schnitt das Ende des Bartes ab. ::: Sobald der Zwerg sich frei fühlte, griff er nach einem Sack, der zwischen den Wurzeln des Baums steckte und mit Gold gefüllt war, hob ihn heraus und brummte vor sich hin „ungehobeltes Volk, schneidet mir ein Stück von meinem stolzen Barte ab! Lohn's euch der Kuckuck!“ ::: Damit schwang er seinen Sack auf den Rücken und ging fort ohne die Kinder nur noch einmal anzusehen. Einige Zeit danach wollten Schneeweißchen und Rosenrot ein Gericht Fische angeln. ::: Als sie nahe bei dem Bach waren, sahen sie dass etwas wie eine große Heuschrecke nach dem Wasser zu hüpfte, als wollte es hinein springen. Sie liefen heran und erkannten den Zwerg. ::: „Wo willst du hin?“ sagte Rosenrot, „du willst doch nicht ins Wasser?“ „Solch ein Narr bin ich nicht,“ schrie der Zwerg, „seht ihr nicht, der verwünschte Fisch will mich hinein ziehen?“ ::: Der Kleine hatte da gesessen und geangelt, und unglücklicher Weise hatte der Wind seinen Bart mit der Angelschnur verflochten: als gleich darauf ein großer Fisch anbiss, fehlten dem schwachen Geschöpf die Kräfte ihn herauszuziehen: der Fisch behielt die Oberhand und riss den Zwerg zu sich hin. ::: Zwar hielt er sich an allen Halmen und Binsen, aber das half nicht viel, er mußte den Bewegungen des Fisches folgen, und war in beständiger Gefahr ins Wasser gezogen zu werden. ::: Die Mädchen kamen zu rechter Zeit, hielten ihn fest und versuchten den Bart von der Schnur loszumachen, aber vergebens, Bart und Schnur waren fest in einander verwirrt. ::: Es blieb nichts übrig als die Schere hervor zu holen und den Bart abzuschneiden, wobei ein kleiner Teil desselben verloren ging. ::: Als der Zwerg das sah, schrie er sie an, „ist das Manier, ihr Lorche, einem das Gesicht zu schänden? nicht genug, dass ihr mir den Bart unten abgestutzt habt, jetzt schneidet ihr mir den besten Teil davon ab: ich darf mich vor den Meinigen gar nicht sehen lassen. Dass ihr laufen müsstet und die Schuhsohlen verloren hättet!“ ::: Dann holte er einen Sack Perlen, der im Schilfe lag, und ohne ein Wort weiter zu sagen, schleppte er ihn fort und verschwand hinter einem Stein. Es trug sich zu, dass bald hernach die Mutter die beiden Mädchen nach der Stadt schickte, Zwirn Nadeln Schnüre und Bänder einzukaufen. Der Weg führte sie über eine Heide, auf der hier und da mächtige Felsenstücke zerstreut lagen. ::: Da sahen sie einen großen Vogel in der Luft schweben, der langsam über ihnen kreiste, sich immer tiefer herab senkte und endlich nicht weit bei einem Felsen niederstieß. Gleich darauf hörten sie einen durchdringenden, jämmerlichen Schrei. ::: Sie liefen herzu und sahen mit Schrecken dass der Adler ihren alten Bekannten, den Zwerg, gepackt hatte und ihn forttragen wollte. Die mitleidigen Kinder hielten gleich das Männchen fest und zerrten sich so lange mit dem Adler herum, bis er seine Beute fahren ließ. ::: Als der Zwerg sich von dem ersten Schrecken erholt hatte, schrie er mit seiner kreischenden Stimme „konntet ihr nicht säuberlicher mit mir umgehen? gerissen habt ihr an meinem dünnen Röckchen dass es überall zerfetzt und durchlöchert ist, unbeholfenes und täppisches Gesindel, das ihr seid!“ Dann nahm er einen Sack mit Edelsteinen und schlüpfte wieder unter den Felsen in seine Höhle. ::: Die Mädchen waren an seinen Undank schon gewöhnt, setzten ihren Weg fort und verrichteten ihr Geschäft in der Stadt. ::: Als sie beim Heimweg wieder auf die Heide kamen, überraschten sie den Zwerg, der auf einem reinlichen Plätzchen seinen Sack mit Edelsteinen ausgeschüttet und nicht gedacht hatte dass so spät noch jemand daher kommen würde. ::: Die Abendsonne schien über die glänzenden Steine, sie schimmerten und leuchteten so prächtig in allen Farben, dass die Kinder stehenblieben und sie betrachteten. „Was steht ihr da und gafft!“ schrie der Zwerg, und sein aschgraues Gesicht ward zinnoberrot vor Zorn. ::: Er wollte mit seinen Scheltworten fortfahren, als sich ein lautes Brummen hören ließ und ein schwarzer Bär aus dem Walde herbei trabte. ::: Erschrocken sprang der Zwerg auf, aber er konnte nicht mehr zu seinem Schlupfwinkel gelangen, der Bär war schon in seiner Nähe. Da rief er in Herzensangst „lieber Herr Bär, verschont mich, ich will euch alle meine Schätze geben, sehet, die schönen Edelsteine, die da liegen. ::: Schenkt mir das Leben, was habt ihr an mir kleinen schmächtigen Kerl? Ihr spürt mich nicht zwischen den Zähnen: da, die beiden gottlosen Mädchen packt, das sind für euch zarte Bissen, fett wie junge Wachteln, die fresst in Gottes Namen.“ ::: Der Bär kümmerte sich um seine Worte nicht, gab dem boshaften Geschöpf einen einzigen Schlag mit der Tatze, und es regte sich nicht mehr. Die Mädchen waren fortgesprungen, aber der Bär rief ihnen nach „Schneeweißchen und Rosenrot, fürchtet euch nicht, wartet ich will mit euch gehen.“ ::: Da erkannten sie seine Stimme und blieben stehen, und als der Bär bei ihnen war, fiel plötzlich die Bärenhaut ab, und er stand da als ein schöner Mann, und war ganz in Gold gekleidet. „Ich bin eines Königs Sohn,“ sprach er, „und war von dem gottlosen Zwerg, der mir meine Schätze gestohlen hatte, verwünscht als ein wilder Bär in dem Walde zu laufen, bis ich durch seinen Tod erlöst würde. Jetzt hat er seine wohlverdiente Strafe empfangen.“ ::: Schneeweißchen ward mit ihm vermählt und Rosenrot mit seinem Bruder und sie teilten die großen Schätze mit einander, die der Zwerg in seine Höhle zusammen getragen hatte. ::: Die alte Mutter lebte noch lange Jahre ruhig und glücklich bei ihren Kindern. Die zwei Rosenbäumchen aber nahm sie mit, und sie standen vor ihrem Fenster und trugen jedes Jahr die schönsten Rosen, weiß und rot.
Schneeweißchen und Rosenrot-51
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-51' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-51' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-4
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-4' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-4' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-33
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-33' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-33' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-17
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-17' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-17' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-38
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-38' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-38' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-54
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-54' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-54' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-19
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-19' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-19' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-45
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-45' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-45' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-29
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-29' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-29' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-46
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-46' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-46' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-15
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-15' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-15' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-26
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-26' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-26' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-13
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-13' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-13' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-40
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-40' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-40' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-10
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-10' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-10' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-37
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-37' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-37' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-43
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-43' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-43' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-25
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-25' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-25' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-6
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-6' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-6' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-9
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-9' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-9' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-8
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-8' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-8' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-23
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-23' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-23' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-22
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-22' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-22' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-41
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-41' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-41' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-27
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-27' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-27' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-36
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-36' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-36' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-7
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-7' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-7' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-1
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-1' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-1' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-39
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-39' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-39' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-30
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-30' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-30' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-34
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-34' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-34' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-48
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-48' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-48' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-32
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-32' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-32' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-11
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-11' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-11' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-44
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-44' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-44' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-18
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-18' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-18' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-16
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-16' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-16' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-35
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-35' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-35' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-42
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-42' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-42' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-5
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-5' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-5' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-21
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-21' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-21' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-2
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-2' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-2' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-14
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-14' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-14' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-3
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-3' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-3' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-31
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-31' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-31' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-50
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-50' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-50' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-47
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-47' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-47' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-52
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-52' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-52' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-12
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-12' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-12' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-53
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-53' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-53' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-24
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-24' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-24' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-20
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-20' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-20' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-49
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-49' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-49' by dorothea-mueller
Schneeweißchen und Rosenrot-28
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-28' by dorothea-mueller
Record of 'Schneeweißchen und Rosenrot-28' by dorothea-mueller
Tischchen deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack
Vor Zeiten war ein Schneider, der drei Söhne hatte und nur eine einzige Ziege. Aber die Ziege, weil sie alle zusammen mit ihrer Milch ernährte, musste ihr gutes Futter haben und täglich hinaus auf die Weide geführt werden. ::: Die Söhne taten das auch nach der Reihe. Einmal brachte sie der älteste auf den Kirchhof, wo die schönsten Kräuter standen, ließ sie da fressen und herumspringen. ::: Abends, als es Zeit war heim zu gehen, fragte er „Ziege, bist du satt?“ Die Ziege antwortete „ich bin so satt, ich mag kein Blatt: meh! meh!“ „So komm nach Haus“ sprach der Junge, fasste sie am Strickchen, führte sie in den Stall und band sie fest. ::: „Nun,“ sagte der alte Schneider, „hat die Ziege ihr gehöriges Futter?“ „O,“ antwortete der Sohn, „die ist so satt, sie mag kein Blatt.“ ::: Der Vater aber wollte sich selbst überzeugen, ging hinab in den Stall, streichelte das liebe Tier und fragte „Ziege, bist du auch satt?“ Die Ziege antwortete „wovon sollt ich satt sein? ich sprang nur über Gräbelein, und fand kein einzig Blättelein: meh! meh!“ ::: „Was muss ich hören!“ rief der Schneider, lief hinauf und sprach zu dem Jungen „ei, du Lügner, sagst die Ziege wäre satt, und hast sie hungern lassen?“ und in seinem Zorne nahm er die Elle von der Wand und jagte ihn mit Schlägen hinaus. ::: Am andern Tag war die Reihe am zweiten Sohn, der suchte an der Gartenhecke einen Platz aus, wo lauter gute Kräuter standen, und die Ziege fraß sie rein ab. Abends, als er heim wollte, fragte er „Ziege, bist du satt?“ ::: Die Ziege antwortete „ich bin so satt, ich mag kein Blatt: meh! meh!“ „So komm nach Haus,“ sprach der Junge, zog sie heim und band sie im Stalle fest. „Nun,“ sagte der alte Schneider, „hat die Ziege ihr gehöriges Futter?“ ::: „O,“ antwortete der Sohn, „die ist so satt, sie mag kein Blatt.“ Der Schneider wollte sich darauf nicht verlassen, ging hinab in den Stall und fragte „Ziege, bist du auch satt?“ ::: Die Ziege antwortete „wovon sollt ich satt sein? ich sprang nur über Gräbelein, und fand kein einzig Blättelein: meh! meh!“ „Der gottlose Bösewicht!“ schrie der Schneider, „so ein frommes Tier hungern zu lassen!“ lief hinauf, und schlug mit der Elle den Jungen zur Haustüre hinaus. ::: Die Reihe kam jetzt an den dritten Sohn, der wollte seine Sache gut machen, suchte Buschwerk mit dem schönsten Laube aus, und ließ die Ziege daran fressen. Abends, als er heim wollte, fragte er „Ziege, bist du auch satt?“ ::: Die Ziege antwortete „ich bin so satt, ich mag kein Blatt: meh! meh!“ „So komm nach Haus,“ sagte der Junge, führte sie in den Stall und band sie fest. „Nun,“ sagte der alte Schneider, „hat die Ziege ihr gehöriges Futter?“ ::: „O,“ antwortete der Sohn, „die ist so satt, sie mag kein Blatt.“ Der Schneider traute nicht, ging hinab und fragte „Ziege, bist du auch satt?“ ::: Das boshafte Tier antwortete „wovon sollt ich satt sein? ich sprang nur über Gräbelein, und fand kein einzig Blättlein: meh! meh!“ ::: „O die Lügenbrut!“ rief der Schneider, „einer so gottlos und pflichtvergessen wie der andere! Ihr sollt mich nicht länger zum Narren haben!“ und vor Zorn ganz außer sich sprang er hinauf und gerbte dem armen Jungen mit der Elle den Rücken so gewaltig, dass er zum Haus hinaus sprang. ::: Der alte Schneider war nun mit seiner Ziege allein. Am andern Morgen ging er hinab in den Stall, liebkoste die Ziege und sprach „komm, mein liebes Tierlein, ich will dich selbst zur Weide führen.“ ::: Er nahm sie am Strick und brachte sie zu grünen Hecken und unter Schafrippe und was sonst die Ziegen gerne fressen. „Da kannst du dich einmal nach Herzenslust sättigen“ sprach er zu ihr, und ließ sie weiden bis zum Abend. Da fragte er „Ziege, bist du satt?“ Sie antwortete „ich bin so satt, ich mag kein Blatt: meh! meh!“ ::: „So komm nach Haus“ sagte der Schneider, führte sie in den Stall und band sie fest. Als er wegging, kehrte er sich noch einmal um, und sagte „nun bist du doch einmal satt!“ ::: Aber die Ziege machte es ihm nicht besser und rief „wie sollt ich satt sein? ich sprang nur über Gräbelein, und fand kein einzig Blättlein: meh! meh!“ ::: Als der Schneider das hörte, stutzte er und sah wohl dass er seine drei Söhne ohne Ursache verstoßen hatte. „Wart,“ rief er, „du undankbares Geschöpf, dich fortzujagen ist noch zu wenig, ich will dich zeichnen dass du dich unter ehrbaren Schneidern nicht mehr darfst sehen lassen.“ ::: In einer Hast sprang er hinauf, holte sein Bartmesser, seifte der Ziege den Kopf ein, und schor sie so glatt wie seine flache Hand. ::: Und weil die Elle zu ehrenvoll gewesen wäre, holte er die Peitsche und versetzte ihr solche Hiebe, dass sie in gewaltigen Sprüngen davon lief. ::: Der Schneider, als er so ganz einsam in seinem Hause saß, verfiel in große Traurigkeit und hätte seine Söhne gerne wieder gehabt, aber niemand wusste wo sie hingeraten waren. ::: Der älteste war zu einem Schreiner in die Lehre gegangen, da lernte er fleißig und unverdrossen, und als seine Zeit herum war, dass er wandern sollte, schenkte ihm der Meister ein Tischchen, das gar kein besonderes Ansehen hatte und von gewöhnlichem Holz war: aber es hatte eine gute Eigenschaft. ::: Wenn man es hinstellte, und sprach „Tischchen, deck dich,“ so war das gute Tischchen auf einmal mit einem saubern Tüchlein bedeckt, und stand da ein Teller, und Messer und Gabel daneben, und Schüsseln mit Gesottenem und Gebratenem, so viel Platz hatten, und ein großes Glas mit rotem Wein leuchtete dass einem das Herz lachte. ::: Der junge Gesell dachte „damit hast du genug für dein Lebtag,“ zog guter Dinge in der Welt umher und bekümmerte sich gar nicht darum ob ein Wirtshaus gut oder schlecht und ob etwas darin zu finden war, oder nicht. ::: Wenn es ihm gefiel, so kehrte er gar nicht ein, sondern im Felde, im Wald, auf einer Wiese, wo er Lust hatte, nahm er sein Tischchen vom Rücken, stellte es vor sich und sprach „deck dich,“ so war alles da, was sein Herz begehrte. ::: Endlich kam es ihm in den Sinn, er wollte zu seinem Vater zurückkehren, sein Zorn würde sich gelegt haben, und mit dem Tischchen deck dich würde er ihn gerne wieder aufnehmen. ::: Es trug sich zu, dass er auf dem Heimweg abends in ein Wirtshaus kam, das mit Gästen angefüllt war: sie hießen ihn willkommen und luden ihn ein sich zu ihnen zu setzen und mit ihnen zu essen, sonst würde er schwerlich noch etwas bekommen. ::: „Nein,“ antwortete der Schreiner, „die paar Bissen will ich euch nicht vor dem Munde nehmen, lieber sollt ihr meine Gäste sein.“ ::: Sie lachten und meinten er triebe seinen Spaß mit ihnen. Er aber stellte sein hölzernes Tischchen mitten in die Stube und sprach „Tischchen, deck dich.“ Augenblicklich war es mit Speisen besetzt, so gut wie sie der Wirt nicht hätte herbeischaffen können, und wovon der Geruch den Gästen lieblich in die Nase stieg. ::: „Zugegriffen, liebe Freunde,“ sprach der Schreiner, und die Gäste, als sie sahen wie es gemeint war, ließen sich nicht zweimal bitten, rückten heran, zogen ihre Messer und griffen tapfer zu. ::: Und was sie am meisten verwunderte, wenn eine Schüssel leer geworden war, so stellte sich gleich von selbst eine volle an ihren Platz. Der Wirt stand in einer Ecke und sah dem Dinge zu; er wusste gar nicht was er sagen sollte, dachte aber „einen solchen Koch könntest du in deiner Wirtschaft wohl brauchen.“ ::: Der Schreiner und seine Gesellschaft waren lustig bis in die späte Nacht, endlich legten sie sich schlafen, und der junge Geselle ging auch zu Bett und stellte seinen Wünschtisch an die Wand. ::: Dem Wirte aber ließen seine Gedanken keine Ruhe, es fiel ihm ein dass in seiner Rumpelkammer ein altes Tischchen stand, das gerade so aussähe: das holte er ganz sachte herbei und vertauschte es mit dem Wünschtisch. ::: Am andern Morgen zahlte der Schreiner sein Schlafgeld, packte sein Tischchen auf, dachte gar nicht daran dass er ein falsches hätte und ging seiner Wege. ::: Zu Mittag kam er bei seinem Vater an, der ihn mit großer Freude empfing. „Nun, mein lieber Sohn, was hast du gelernt?“ sagte er zu ihm. ::: „Vater, ich bin ein Schreiner geworden.“ „Ein gutes Handwerk,“ erwiderte der Alte, „aber was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht?“ „Vater, das beste, was ich mitgebracht habe, ist das Tischchen.“ ::: Der Schneider betrachtete es von allen Seiten und sagte „daran hast du kein Meisterstück gemacht, das ist ein altes und schlechtes Tischchen.“ ::: „Aber es ist ein Tischchen deck dich,“ antwortete der Sohn, „wenn ich es hinstelle, und sage ihm es sollte sich decken, so stehen gleich die schönsten Gerichte darauf und ein Wein dabei, der das Herz erfreut. ::: Ladet nur alle Verwandte und Freunde ein, die sollen sich einmal laben und erquicken, denn das Tischchen macht sie alle satt.“ Als die Gesellschaft beisammen war, stellte er sein Tischchen mitten in die Stube und sprach „Tischchen, deck dich.“ ::: Aber das Tischchen regte sich nicht und blieb so leer wie ein anderer Tisch, der die Sprache nicht versteht. Da merkte der arme Geselle dass ihm das Tischchen vertauscht war, und schämte sich dass er wie ein Lügner da stand. ::: Die Verwandten aber lachten ihn aus, und mussten ungetrunken und ungegessen wieder heim wandern. Der Vater holte seine Lappen wieder herbei und schneiderte fort, der Sohn aber ging bei einem Meister in die Arbeit. ::: Der zweite Sohn war zu einem Müller gekommen und bei ihm in die Lehre gegangen. Als er seine Jahre herum hatte, sprach der Meister „weil du dich so wohl gehalten hast, so schenke ich dir einen Esel von einer besondern Art, er zieht nicht am Wagen und trägt auch keine Säcke.“ ::: „Wozu ist er denn nütze?“ fragte der junge Geselle. „Er speit Gold,“ antwortete der Müller, „wenn du ihn auf ein Tuch stellst und sprichst „Bricklebrit,“ so speit dir das gute Tier Goldstücke aus, hinten und vorn.“ ::: „Das ist eine schöne Sache,“ sprach der Geselle, dankte dem Meister und zog in die Welt. Wenn er Gold nötig hatte, brauchte er nur zu seinem Esel „Bricklebrit“ zu sagen, so regnete es Goldstücke, und er hatte weiter keine Mühe als sie von der Erde aufzuheben. ::: Wo er hinkam, war ihm das beste gut genug, und je teurer je lieber, denn er hatte immer einen vollen Beutel. Als er sich eine Zeit lang in der Welt umgesehen hatte, dachte er „du musst deinen Vater aufsuchen, wenn du mit dem Goldesel kommst, so wird er seinen Zorn vergessen und dich gut aufnehmen.“ ::: Es trug sich zu, dass er in dasselbe Wirtshaus geriet, in welchem seinem Bruder das Tischchen vertauscht war. ::: Er führte seinen Esel an der Hand, und der Wirt wollte ihm das Tier abnehmen und anbinden, der junge Geselle aber sprach „gebt euch keine Mühe, meinen Grauschimmel führe ich selbst in den Stall und binde ihn auch selbst an, denn ich muss wissen wo er steht.“ ::: Dem Wirt kam das wunderlich vor, und er meinte einer, der seinen Esel selbst besorgen müsste, hätte nicht viel zu verzehren: als aber der Fremde in die Tasche griff, zwei Goldstücke heraus holte und sagte er sollte nur etwas Gutes für ihn einkaufen, so machte er große Augen, lief und suchte das beste, das er auftreiben konnte. ::: Nach der Mahlzeit fragte der Gast was er schuldig wäre, der Wirt wollte die doppelte Kreide nicht sparen und sagte noch ein paar Goldstücke müsste er zulegen. ::: Der Geselle griff in die Tasche, aber sein Gold war eben zu Ende. „Wartet einen Augenblick, Herr Wirt,“ sprach er, „ich will nur gehen und Gold holen;“ nahm aber das Tischtuch mit. ::: Der Wirt wusste nicht was das heißen sollte, war neugierig, schlich ihm nach, und da der Gast die Stalltüre zuriegelte, so guckte er durch ein Astloch. ::: Der Fremde breitete unter dem Esel das Tuch aus, rief „Bricklebrit,“ und augenblicklich fing das Tier an Gold zu speien von hinten und vorn, dass es ordentlich auf die Erde herabregnete. „Ei der tausend,“ sagte der Wirt, „da sind die Münzen bald geprägt! So ein Geldbeutel ist nicht übel!“ ::: Der Gast bezahlte seine Rechnung und legte sich schlafen, der Wirt aber schlich in der Nacht herab in den Stall, führte den Münzmeister weg und band einen andern Esel an seine Stelle. ::: Den folgenden Morgen in der Frühe zog der Geselle mit seinem Esel ab und meinte er hätte seinen Goldesel. Mittags kam er bei seinem Vater an, der sich freute als er ihn wiedersah und ihn gerne aufnahm. ::: „Was ist aus dir geworden, mein Sohn?“ fragte der Alte. „Ein Müller, lieber Vater,“ antwortete er. „Was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht?“ „Weiter nichts als einen Esel.“ „Esel gibts hier genug,“ sagte der Vater, „da wäre mir doch eine gute Ziege lieber gewesen.“ ::: „Ja,“ antwortete der Sohn, „aber es ist kein gemeiner Esel, sondern ein Goldesel: wenn ich sage „Bricklebrit,“ so speit euch das gute Tier ein ganzes Tuch voll Goldstücke. Lasst nur alle Verwandte herbei rufen, ich mache sie alle zu reichen Leuten.“ ::: „Das lass ich mir gefallen,“ sagte der Schneider, „dann brauch ich mich mit der Nadel nicht weiter zu quälen,“ sprang selbst fort, und rief die Verwandten herbei. ::: Sobald sie beisammen waren, hieß sie der Müller Platz machen, breitete sein Tuch aus, und brachte den Esel in die Stube. „Jetzt gebt acht“ sagte er und rief „Bricklebrit,“ aber es waren keine Goldstücke was herabfiel, und es zeigte sich, dass das Tier nichts von der Kunst verstand, denn es bringts nicht jeder Esel so weit. ::: Da machte der arme Müller ein langes Gesicht, sah dass er betrogen war und bat die Verwandten um Verzeihung, die so arm heim gingen, als sie gekommen waren. ::: Es blieb nichts übrig, der Alte musste wieder nach der Nadel greifen, und der Junge sich bei einem Müller verdingen. ::: Der dritte Bruder war zu einem Drechsler in die Lehre gegangen, und weil es ein kunstreiches Handwerk ist, musste er am längsten lernen. Seine Brüder aber meldeten ihm in einem Briefe wie schlimm es ihnen ergangen wäre, und wie sie der Wirt noch am letzten Abende um ihre schönen Wünschdinge gebracht hätte. ::: Als der Drechsler nun ausgelernt hatte und wandern sollte, so schenkte ihm sein Meister, weil er sich so wohl gehalten, einen Sack, und sagte „es liegt ein Knüppel darin.“ ::: „Den Sack kann ich umhängen, und er kann mir gute Dienste leisten, aber was soll der Knüppel darin? der macht ihn nur schwer.“ ::: „Das will ich dir sagen,“ antwortete der Meister, „hat dir jemand etwas zu leid getan, so sprich nur „Knüppel, aus dem Sack,“ so springt dir der Knüppel heraus unter die Leute und tanzt ihnen so lustig auf dem Rücken herum, dass sie sich acht Tage lang nicht regen und bewegen können; und eher lässt er nicht ab als bis du sagst: „Knüppel, in den Sack.“ ::: Der Gesell dankte ihm, hing den Sack um, und wenn ihm jemand zu nahe kam und auf den Leib wollte, so sprach er „Knüppel, aus dem Sack,“ alsbald sprang der Knüppel heraus und klopfte einem nach dem andern den Rock oder Wams gleich auf dem Rücken aus, und wartete nicht erst bis er ihn ausgezogen hatte; und das ging so geschwind, daß eh sichs einer versah die Reihe schon an ihm war. ::: Der junge Drechsler langte zur Abendzeit in dem Wirtshaus an, wo seine Brüder waren betrogen worden. Er legte seinen Ranzen vor sich auf den Tisch und fing an zu erzählen was er alles merkwürdiges in der Welt gesehen habe. ::: „Ja,“ sagte er, „man findet wohl ein Tischchen deck dich, einen Goldesel und dergleichen: lauter gute Dinge, die ich nicht verachte, aber das ist alles nichts gegen den Schatz, den ich mir erworben habe und mit mir da in meinem Sack führe.“ ::: Der Wirt spitzte die Ohren: „was in aller Welt mag das sein?“ dachte er „der Sack ist wohl mit lauter Edelsteinen angefüllt; den sollte ich billig auch noch haben, denn aller guten Dinge sind drei.“ ::: Als Schlafenszeit war, streckte sich der Gast auf die Bank und legte seinen Sack als Kopfkissen unter. Der Wirt als er meinte der Gast läge in tiefem Schlaf, ging herbei, rückte und zog ganz sachte und vorsichtig an dem Sack, ob er ihn vielleicht wegziehen und einen andern unterlegen könnte. ::: Der Drechsler aber hatte schon lange darauf gewartet, wie nun der Wirt eben einen herzhaften Ruck tun wollte, rief er „Knüppel, aus dem Sack.“ Alsbald fuhr das Knüppelchen heraus, dem Wirt auf den Leib, und rieb ihm die Nähte dass es eine Art hatte. ::: Der Wirt schrie zum Erbarmen, aber je lauter er schrie, desto kräftiger schlug der Knüppel ihm den Takt dazu auf dem Rücken, bis er endlich erschöpft zur Erde fiel. ::: Da sprach der Drechsler „wo du das Tischchen deck dich und den Goldesel nicht wieder heraus gibst, so soll der Tanz von neuem angehen.“ ::: „Ach nein,“ rief der Wirt ganz kleinlaut, „ich gebe alles gerne wieder heraus, lasst nur den verwünschten Kobold wieder in den Sack kriechen.“ ::: Da sprach der Geselle „ich will Gnade für Recht ergehen lassen, aber hüte dich vor Schaden!“ dann rief er „Knüppel, in den Sack!“ und ließ ihn ruhen. ::: Der Drechsler zog am andern Morgen mit dem Tischchen deck dich und dem Goldesel heim zu seinem Vater. Der Schneider freute sich als er ihn wieder sah, und fragte auch ihn was er in der Fremde gelernt hätte. ::: „Lieber Vater,“ antwortete er, „ich bin ein Drechsler geworden.“ „Ein kunstreiches Handwerk,“ sagte der Vater, „was hast du von der Wanderschaft mitgebracht?“ „Ein kostbares Stück, lieber Vater,“ antwortete der Sohn, „einen Knüppel in dem Sack.“ ::: „Was!“ rief der Vater, „einen Knüppel! das ist der Mühe wert! den kannst du dir von jedem Baume abhauen.“ ::: „Aber einen solchen nicht, lieber Vater: sage ich „Knüppel, aus dem Sack,“ so springt der Knüppel heraus und macht mit dem, der es nicht gut mit mir meint, einen schlimmen Tanz, und lässt nicht eher nach als bis er auf der Erde liegt und um gut Wetter bittet. ::: Seht ihr, mit diesem Knüppel habe ich das Tischchen deck dich und den Goldesel wieder herbei geschafft, die der diebische Wirt meinen Brüdern abgenommen hatte. ::: Jetzt lasst sie beide rufen und ladet alle Verwandten ein, ich will sie speisen und tränken und will ihnen die Taschen noch mit Gold füllen.“ ::: Der alte Schneider wollte nicht recht trauen, brachte aber doch die Verwandten zusammen. Da deckte der Drechsler ein Tuch in die Stube, führte den Goldesel herein und sagte zu seinem Bruder „nun, lieber Bruder, sprich mit ihm.“ ::: Der Müller sagte „Bricklebrit,“ und augenblicklich sprangen die Goldstücke auf das Tuch herab, als käme ein Platzregen, und der Esel hörte nicht eher auf als bis alle so viel hatten, dass sie nicht mehr tragen konnten. ::: (Ich sehe dirs an, du wärst auch gerne dabei gewesen.) ::: Dann holte der Drechsler das Tischchen und sagte „lieber Bruder, nun sprich mit ihm.“ Und kaum hatte der Schreiner „Tischchen deck dich“ gesagt, so war es gedeckt und mit den schönsten Schüsseln reichlich besetzt. ::: Da ward eine Mahlzeit gehalten, wie der gute Schneider noch keine in seinem Hause erlebt hatte, und die ganze Verwandtschaft blieb beisammen bis in die Nacht, und waren alle lustig und vergnügt. ::: Der Schneider verschloss Nadel und Zwirn, Elle und Bügeleisen in einen Schrank, und lebte mit seinen drei Söhnen in Freude und Herrlichkeit. Wo ist aber die Ziege hingekommen, die Schuld war dass der Schneider seine drei Söhne fortjagte? Das will ich dir sagen. ::: Sie schämte sich dass sie einen kahlen Kopf hatte, lief in eine Fuchshöhle und verkroch sich hinein. Als der Fuchs nach Haus kam, funkelten ihm ein paar große Augen aus der Dunkelheit entgegen, dass er erschrak und wieder zurücklief. ::: Der Bär begegnete ihm, und da der Fuchs ganz verstört aussah, so sprach er „was ist dir, Bruder Fuchs, was machst du für ein Gesicht?“ „Ach,“ antwortete der Rothe, „ein grimmig Tier sitzt in meiner Höhle und hat mich mit feurigen Augen angeglotzt.“ ::: „Das wollen wir bald austreiben,“ sprach der Bär, ging mit zu der Höhle und schaute hinein; als er aber die feurigen Augen erblickte, wandelte ihn ebenfalls Furcht an: er wollte mit dem grimmigen Tiere nichts zu tun haben und nahm Reißaus. ::: Die Biene begegnete ihm, und da sie merkte dass es ihm in seiner Haut nicht wohl zu Mute war, sprach sie „Bär, du machst ja ein gewaltig verdrießlich Gesicht, wo ist deine Lustigkeit geblieben?“ ::: „Du hast gut reden,“ antwortete der Bär, „es sitzt ein grimmiges Tier mit Glotzaugen in dem Hause des Roten, und wir können es nicht herausjagen.“ ::: Die Biene sprach „du dauerst mich, Bär, ich bin ein armes schwaches Geschöpf, das ihr im Wege nicht anguckt, aber ich glaube doch dass ich euch helfen kann.“ ::: Sie flog in die Fuchshöhle, setzte sich der Ziege auf den glatten geschorenen Kopf, und stach sie so gewaltig, dass sie aufsprang, „meh! meh!“ schrie, und wie toll in die Welt hineinlief; und weiß niemand auf diese Stunde wo sie hingelaufen ist.